Frau und Mann, Mutter und Vater, Sorge- und Erwerbsarbeit – die zentralen Unterschiede heteronormativer Gesellschaften lösen sich auf. Ihr Ende lässt eine Differenz zum Vorschein treten, die unsere ganze politische und kulturelle Aufmerksamkeit erfordert: Es geht um Menschen, die schwanger werden können, und solche, die das nicht können.
Im 20. Jahrhundert ist die patriarchale Geschlechterordnung durcheinandergekommen. Alte Gewissheiten darüber, was es bedeutet, eine Frau oder ein Mann zu sein, gelten nicht mehr. Es waren zwei Kräfte, die diese Veränderung bewirkt haben: der Feminismus und der Kapitalismus. Dabei ging es nicht nur um die Befreiung der Frauen aus ihrer Unterordnung unter das Männliche – das feministische Anliegen. Auch ging es nicht nur um die Verwertung weiblicher Arbeitskraft und familiärer Beziehungen für Markt und Profit – das kapitalistische Anliegen.
Sondern das eigentliche Zentrum der Auseinandersetzungen war, wie sich erst heute vollständig zeigt, die Bedeutung von Mutterschaft.
Die reproduktive Differenz
Es ist eine biologische und keine soziale Tatsache, dass sich die menschliche Spezies ausschließlich durch Schwangerschaften und Geburten erneuert. Dabei kann nur knapp die eine Hälfte der Menschen schwanger werden kann, die andere nicht. Diese reproduktive Differenz, die nicht deckungsgleich mit der Geschlechterdifferenz ist, stellt eine Herausforderung für egalitäre Gesellschaften dar. Denn Fortpflanzung lässt sich nicht „gleichberechtigt“ organisieren wie das Einkaufen oder das Badputzen.
Dieser Sachverhalt lässt sich nicht schönreden. Wenn wir sagen, „Peter und Aisha bekommen zusammen ein Kind“, dann verfehlen wir eine Realität, die grundsätzlich ungleich ist: Zwar ist richtig, dass zwei Menschen egalitär und gemeinsam – durch die Verschmelzung von Eizelle und Spermium – einen Embryo erzeugen. Dieser nistet sich aber nur im Uterus einer der Personen ein, und sie allein ist es, die diesen Embryo zur Reife bringen kann.
Die Fortpflanzung teilt und unterscheidet die Menschen erstens in solche, die schwanger werden können, und solche, die es nicht können. Zweitens lässt sie uns als radikal Ungleiche in die Welt eintreten – als bedürftige und auf Fürsorge anderer angewiesenes Kinder. Wir verdanken unsere Existenz der Tatsache, dass andere anders sind als wir, nämlich größer, erwachsener, mit einem „Mehr“ uns gegenüber ausgestattet.
Die Fortpflanzung teilt und unterscheidet die Menschen in solche, die schwanger werden können, und solche, die es nicht können.
Alle Gesellschaften müssen auf diese biologische Ungleichheit Antworten finden. Schwangerwerdenkönnen, das Schwangersein und Gebären sowie die Art und Weise, wie sich Beziehungen zwischen Neugeborenen und den Erwachsenen gestalten, sind notwendiger und zentraler Gegenstand politischer Verhandlungen.
Die patriarchale Lösung
Bevor Feminismus und Kapitalismus das postpatriarchale Durcheinander losgetreten haben, gehorchte die reproduktive Differenz einer klaren Vorgabe – zumindest in christlich-europäisch geprägten Kulturen und nur die will ich in diesem Text analysieren. Sie lautete: Reproduktion, Sexualität und Ehe fallen zusammen. Legitime Kinder konnten also ausschließlich durch ehelichen Geschlechtsverkehr in lebenslangen monogamen Beziehungen zur Welt kommen.
Natürlich entsprach dieses Ideal nicht der Realität. Es gab zahlreiche Ehepaare, die keine Kinder hatten oder haben konnten, und ebenso viele uneheliche Kinder. Doch auf die damit verbundenen Herausforderungen mussten Politik und Kultur keine neuen Antworten finden, schließlich galten die Kegel als „illegitim“. Die betroffenen Menschen mussten also selbst sehen, wie sie in der Welt zurechtkamen oder eben auch nicht.
Die heteronormative Ordnung sorgte dafür, dass Fortpflanzung nicht zum politischen Problem wurde. Als Keimzellen des Staates galten nicht einzelne Menschen, sondern Familien. Sie hatten die Aufgabe, die Probleme und Konflikte der reproduktiven Differenz im Privaten auszutragen und sie nicht nach draußen, in die öffentliche Sphäre dringen zu lassen. Die letzte Entscheidungsbefugnis hatte die Person ohne Uterus, der „Familienvater“. Er war es auch, der die ganze Familie nach außen hin vertrat. Sein Wille war repräsentativ: Er sprach für „seine“ Frauen und Kinder mit. Außerhalb dieser familiären Keimzellen, also in der gesamten res publica, gab es ausschließlich Menschen ohne Uterus. Niemand konnte im öffentlichen Bereich schwanger werden und Probleme verursachen, mit denen man sich politisch hätte beschäftigen müssen. Kein Politiker, kein Universitätsprofessor, kein Priester, kein Richter.

Neben der Erfindung der Familie sorgte auch das Recht für eine Befriedung der reproduktiven Differenz. Bereits die Römer leiteten soziale Mutterschaft aus der Tatsache des Gebärens ab: „Mater semper certa est“, die Mutter ist immer sicher, lautete das römische Gesetz, das die soziale Verpflichtung, ein Kind zu versorgen, derjenigen Person zuwies, die es geboren hatte. Vaterschaft hingegen wurde gerade nicht als biologisches, sondern als soziales Verhältnis definiert: „Pater est quem nuptiae demonstrant“, Vater ist der Mann, der durch Heirat als solcher ausgewiesen ist. Ein verheirateter Mann war automatisch der Vater aller Kinder, die seine Ehefrau zur Welt brachte, egal wessen Sperma an deren Zeugung beteiligt war.
Die patriarchale Antwort auf die Fortpflanzungsfrage zeitigte eine folgenreiche Gleichung: Menschen mit der Fähigkeit zum Schwangerwerden wurden als „Frauen“ , alle anderen als „Männer“ bezeichnet. Als Folge legte sich ein ausgefeiltes System von Geschlechterzuschreibungen über die reproduktive Differenz. Von Geburt an wurden die als „Frauen“ und „Männer“ kategorisierten Menschen in unterschiedliche Rollen gezwängt.
Die Ordnung der lebenslänglich monogamen, heteronormativen Kleinfamilie sorgte über Jahrhunderte hinweg für familienrechtliche Klarheit. Jedes ehelich geborene Kind hatte genau einen Vater und genau eine Mutter, die binäre Ordnung funktionierte. Bis dann im 20. Jahrhundert alles durcheinander geriet.
Die Ordnung der lebenslänglich monogamen, heteronormativen Kleinfamilie sorgte über Jahrhunderte hinweg für familienrechtliche Klarheit.
Am Ende der Gewissheiten
Zunächst verabschiedete sich die lebenslange Ehe, indem sie Scheidungen Platz machte. Danach löste sich die Heteronorm auf. Inzwischen sind lesbische und schwule Paare akzeptiert und auch rechtlich gleichgestellt. Ganz offiziell sind heute Familiengründungen von Menschen möglich – und auch verbreitet –, die beide einen Uterus oder beide keinen haben. Dieser Prozess schreitet weiter voran in Richtung Familien mit mehr als zwei Erwachsenen. In polyamourösen Beziehungen oder beim Co-Parenting fallen Elternschaft und romantische, sexuelle Beziehungen auseinander.
Zeitgleich haben Feministinnen des 20. Jahrhunderts die Gleichsetzung von biologischem und sozialem Geschlecht umfassend kritisiert. Der Queerfeminismus setzt heute der binären Logik von Frau (mit Uterus) und Mann (ohne Uterus) vielfältige und oszillierende Geschlechtsidentitäten entgegen.
Parallel zu diesen sozialen Veränderungen schritt im 20. Jahrhundert die Reproduktionsmedizin deutlich voran. Nicht nur Fortpflanzung und Ehe lassen sich jetzt trennen, sondern auch Fortpflanzung und Sexualität. Dank der In-Vitro-Fertilisation ist seit den 1980er Jahren kein Geschlechtsverkehr mehr notwendig, um ein Kind zu zeugen, und der Anteil der auf andere Weise als durch Geschlechtsverkehr entstandenen Embryonen wächst stetig.
Das sorgt für neue Komplikationen. Zu Beginn der Corona-Pandemie etwa warteten in Kiew Hunderte von Neugeborenen in einem Hotel darauf, abgeholt zu werden: Aufgrund der Reisebeschränkungen konnten ihre rechtlichen Eltern sie nicht in Empfang nehmen. Und die Frauen, die sie geboren hatten, waren nicht mehr zuständig, da sie erstens ihre vereinbarte Dienstleistung – schwanger sein und gebären – erbracht hatten und es zweitens zu diesem „Job“ gehört, aus Eigenschutz keine Bindung mit dem Neugeborenen aufzubauen.

Das ist ein gutes Beispiel für die neuen Herausforderungen, die sich heute für egalitär freiheitliche Politik stellen. Wenn „Mater semper certa est“ nicht mehr gilt, wie lässt sich sicherstellen, dass jedes Baby Eltern hat, die auch tatsächlich verfügbar sind, wenn sie gebraucht werden? Hier sind Phantasie und Pragmatismus gefragt. Vielleicht wäre es möglich, rechtliche Elternschaft an die Anwesenheit bei der Geburt zu binden. Wer sich allzu weit von der Schwangeren entfernt, geht das Risiko ein, das Recht auf Elternschaft für dieses Kind zu verspielen.
All diese Veränderungen erfordern politische und kulturelle Anpassungen. Doch mangels Alternativen leben alte Vorstellungen von Mutter- und Vaterschaft fort. Im deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch steht weiterhin der Satz „Mutter des Kindes ist die Frau, die es geboren hat“, obwohl es in Deutschland heute juristisch möglich ist, dass Männer Kinder gebären. Denn seit 2011 verlangt das Transsexuellengesetz nicht mehr, das biologische Geschlecht operativ an die empfundene Geschlechtsidentität anzupassen. Deshalb können Menschen mit funktionsfähigem Uterus offiziell als Männer anerkannt werden.
Solche und eine Vielzahl weiterer Fragen müssen auf einer möglichst breiten Basis politisch diskutiert werden. Die alten Konzepte von Familie, Mutterschaft und Vaterschaft sind dabei nicht hilfreich. Was wir hingegen brauchen, das wäre so etwas wie eine „Ethik des Schwangerwerdenkönnens“.
Ethische Herausforderungen der reproduktiven Differenz
Die meisten Ethiken orientieren sich am Handeln oder der Gesinnung eines unabhängigen, autonomen und per se männlichen Individuums. Eine Schwangere ist aber kein Individuum, sondern, wie die Philosophin Luce Irigaray es formuliert hat: „Zwei in eins“. Die schwangere Person und der Embryo oder Fötus in ihr sind einerseits keine getrennten Wesen. Ohne den lebendigen Körper der Schwangeren könnte der Embryo nicht existieren. Andererseits sind beide auch kein einziges Wesen. Schließlich trägt jede Schwangerschaft bereits die Gewissheit ihres Endes in sich: ihre Dauer ist von vornherein begrenzt.
In einem philosophischen Diskurs, den bislang fast ausschließlich Menschen ohne Uterus geführt haben, gelten schwangere Personen kaum als vollwertige Individuen oder als Zwei-in-eins-Wesen. Seit Aristoteles sieht man in ihnen eher ein „Gefäß“, einen passiven Nährboden für „seinen“ Samen. So entstand eine ethisch juridische Ordnung, die das Recht auf körperliche Selbstbestimmung für schwangere Menschen außer Kraft setzt. Normalerweise stellen demokratische Gesellschaften dieses Recht über alles: An einer Unfallstelle darf man sogar eine Blutspende verweigern, selbst wenn dadurch Leben gerettet werden kann. Nur Schwangere dürfen nicht über ihren Körper bestimmen. Fast überall auf der Welt ist es verboten, eine unerwünschte Schwangerschaft ohne Auflagen zu beenden, obwohl die Möglichkeit einer Abtreibung besteht und auch seit der Antike bekannt ist.
Reproduktive Selbstbestimmung betrifft auch die Frage, was nach der Geburt passiert, wenn also der Zustand des „Zwei in eins“ endet und in den zweier Individuen übergegangen ist. Wie wird dieser Übergang kulturell gestaltet? Welche Rechte besitzt die ehemals Schwangere in Bezug auf das Kind? Darf man ihr das Baby gewaltsam – etwa auf gesetzlicher Basis – wegnehmen? Welche anderen Erwachsenen haben außer der Gebärenden Rechte in Bezug auf ein Kind? Was ist, wenn sie die soziale Rolle der Mutterschaft ablehnt? Gibt es dann andere Menschen oder soziale Institutionen, denen sie das Kind anvertrauen kann?
Doch in diesen Diskursen sind die Stimmen der Menschen, die schwanger werden können, viel zu leise. Besonders laut hingegen sind die sogenannten „Vaterrechtler“, die Urheberschaft an den Nachkommen auf genetischem Weg einklagen. Doch ein automatisches Sorgerecht für Spermageber würde Schwangere erneut zu Zwangsbeziehungen verpflichten. Eine Frau, die mit dem Sperma eines Mannes schwanger wurde, zu dem sie aufgrund von Gewaltanwendung etwa keine Beziehung wünscht, müsste abtreiben, wenn sie keinen Kontakt zu ihm wünscht. Doch diese Option hat sie in vielen Ländern der Welt nicht einmal.
Weltweit haben nur 55 Prozent der Frauen die volle Entscheidungsmacht über ihre Gesundheitsversorgung, Familienplanung und über die Frage, ob sie Sex haben wollen oder nicht. Die Daten gehen aus einem Bericht des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (2021) hervor. Erfasst wurden 57 mehrheitlich arme Länder in Lateinamerika, Afrika, Asien und Europa, wovon hier 33 aufgeführt sind.
Fazit
Ein Nachdenken über das Schwangerwerdenkönnen steht noch aus. Die alten Konzepte von Vaterschaft und Mutterschaft, von Männlichkeit und Weiblichkeit helfen nicht weiter, genauso wenig die geschlechtsneutrale Rede von „Eltern“. Wollen wir das patriarchale Erbe hinter uns lassen und in eine gemeinsame Zukunft schreiten, müssen wir die reproduktive Differenz ernst nehmen, sichtbar machen und neu verhandeln. Sie braucht unsere ganze Aufmerksamkeit: Wie können wir unter ethischen Aspekten der Freiheit und der körperlichen Selbstbestimmung Reproduktion gesellschaftlich und rechtlich gestalten? Sowohl für Menschen, die ein Kind geboren haben, als auch für Menschen, die nicht schwanger werden können, muss es möglich sein, Eltern zu werden und auch Elternschaft abzulehnen – aber, und das ist der entscheidende Punkt: nicht auf dieselbe Weise.
Jede Lösung, die nicht die Freiheit von Menschen, die schwanger werden können, garantiert, würde das alte patriarchale System lediglich durch ein anderes, genauso gewaltvolles ersetzen.
Auf jeden Fall muss das Recht auf körperliche Selbstbestimmung uneingeschränkt für Menschen mit Uterus gelten, auch im Fall einer Schwangerschaft. Es ist mit ihrer Freiheit nicht zu vereinbaren, dass andere – Spermageber, Gesellschaft, Gesetze – gegen ihren Willen über ein Kind verfügen, das sie unter Einsatz ihres Körpers und gelegentlich ihres Lebens ausgetragen und geboren haben. Außerdem müssen die Nachteile, die sich aus dem Schwangersein und Gebären ergeben, in die Verantwortung der Allgemeinheit fallen: zeitweise körperliche Einschränkungen, medizinische Versorgung, materielle Absicherung in Zeiten von Erwerbsunfähigkeit, Geld, das für die Versorgung des Kindes aufgebracht werden muss. Schließlich ist die Menschheit und nicht die Schwangere auf Reproduktion angewiesen.
Denn egal wie wir neue Familienformen, Leihmutterschaft, Reproduktionsmedizin in Zukunft politisch gestalten: Jede Lösung, die nicht die Freiheit von Menschen, die schwanger werden können, garantiert, würde das alte patriarchale System lediglich durch ein anderes, genauso gewaltvolles ersetzen.
uncode-placeholder
Antje Schrupp
Antje Schrupp ist promovierte Politikwissenschaftlerin und Journalistin und lebt in Frankfurt am Main. Sie beschäftigt sich vor allem mit weiblicher politischer Ideengeschichte. 2019 erschien ihr Buch Schwangerwerdenkönnen. Essay über Körper, Geschlecht und Politik.



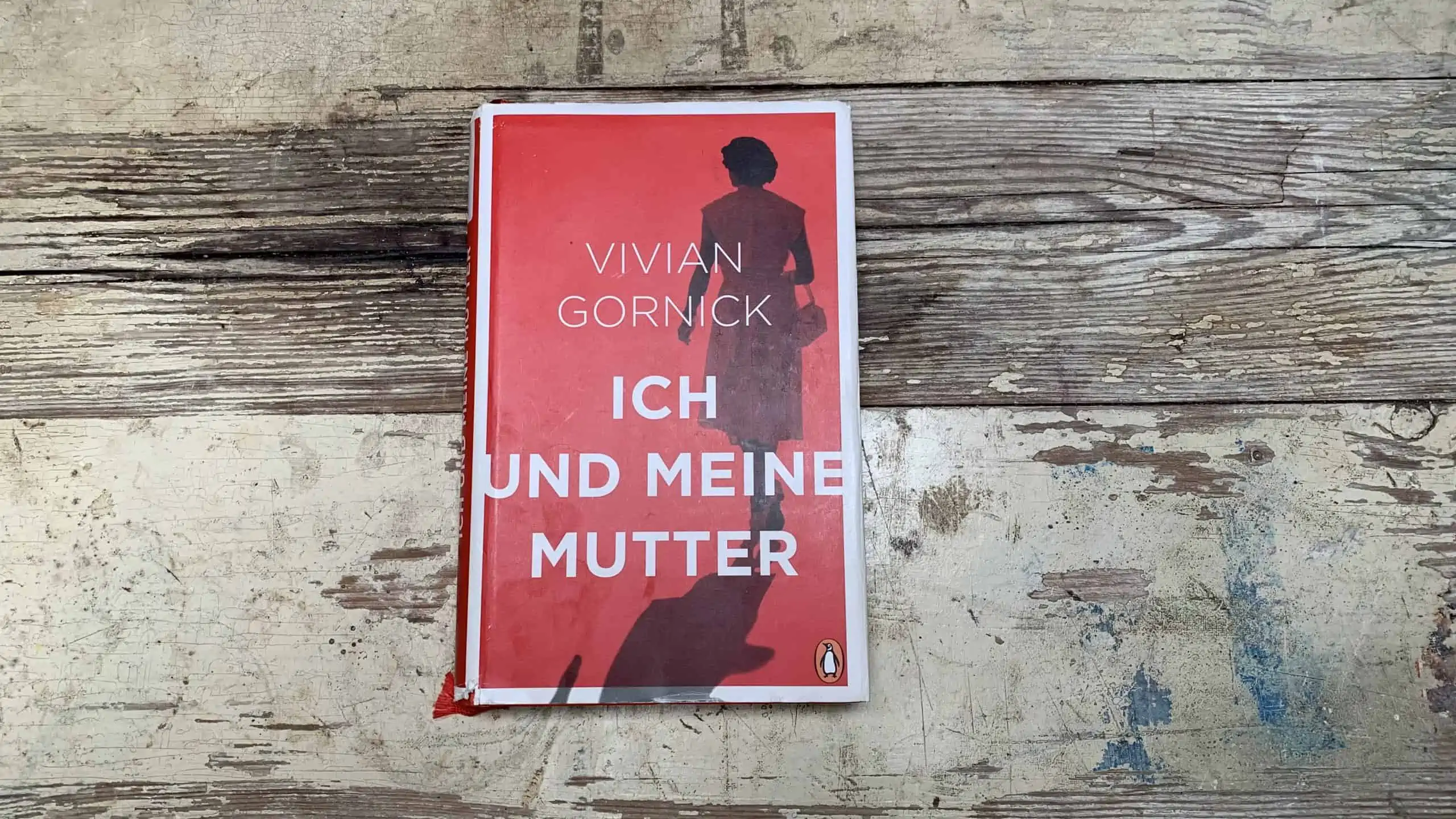
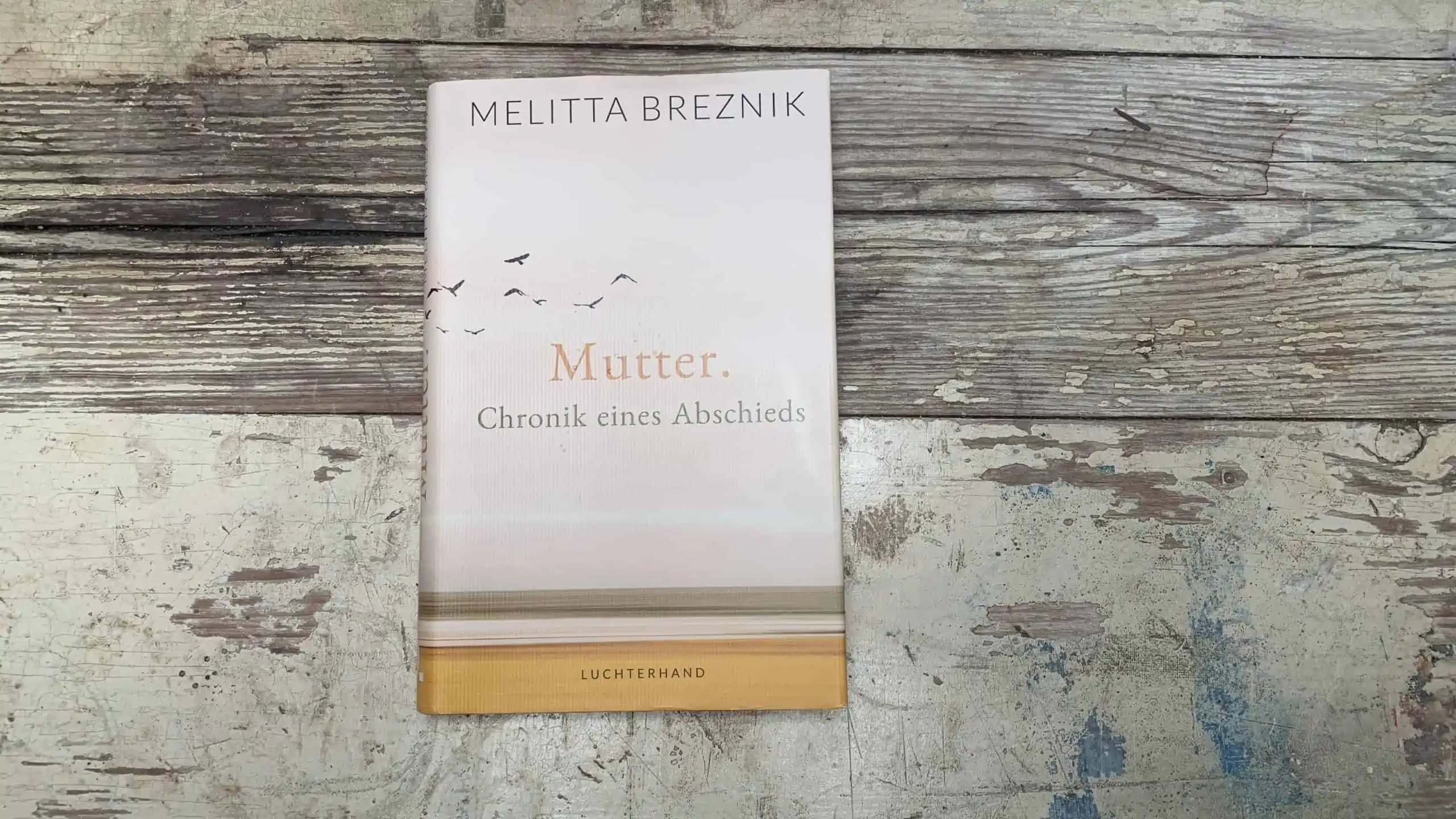





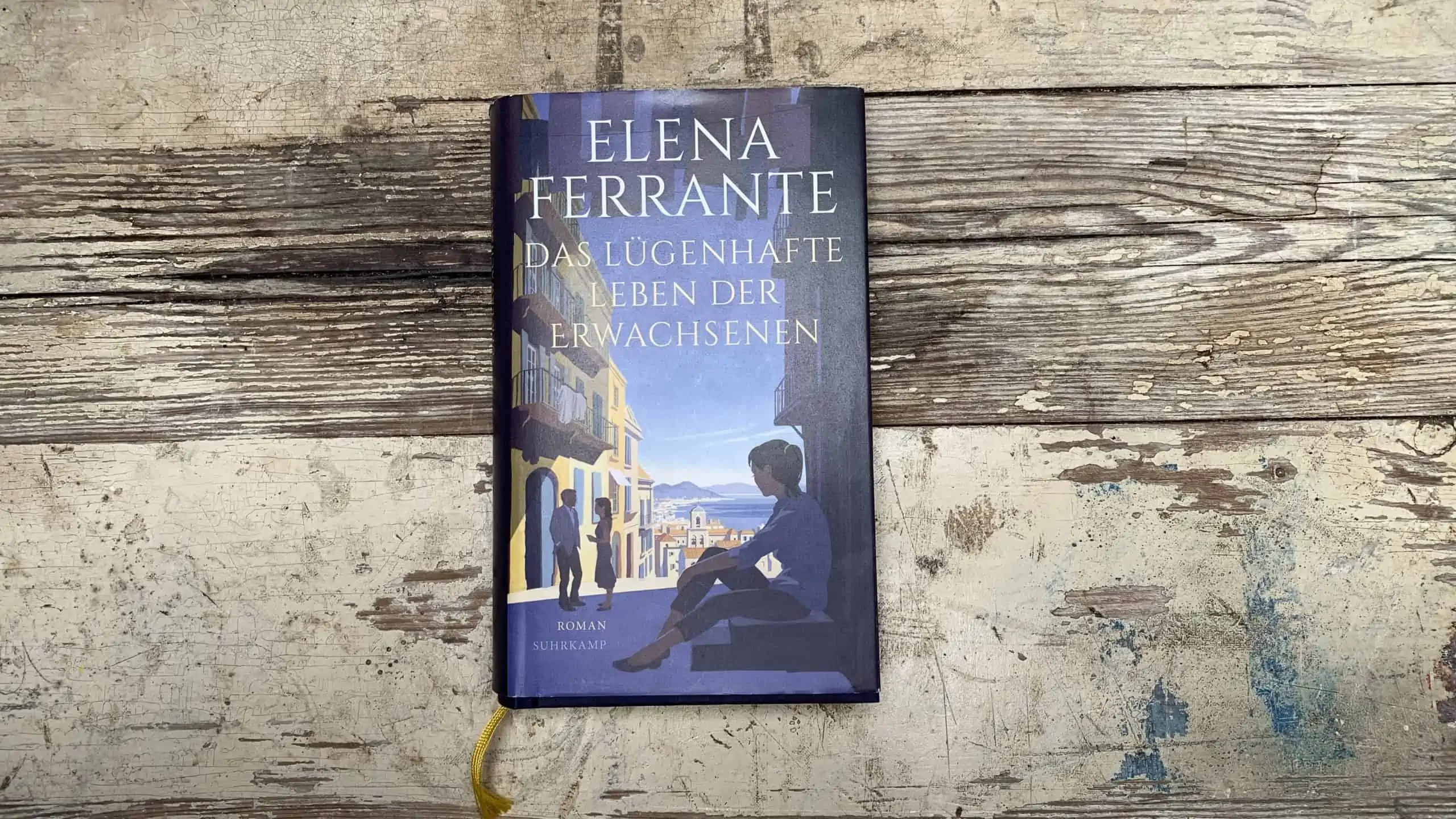

Sehr geehrte Frau Schrupp,
vielen Dank für diese Differenzierung, die das Recht auf körperliche Selbstbestimmung schwangerer Menschen stärkt. Doch wie weit reicht dieser politische boost aus juristischer Sicht? Die deutsche Verfassung schützt das menschliche Leben ab dem Zeitpunkt der Nidation. Sie argumentiert, dass nach der Einnistung der Eizelle in den Uterus ein individuelles, genetisch einmaliges und nicht mehr teilbares Leben vorliege. Damit widerspricht die Verfassung Irigarays Konzept von 2 in 1.
Angesichts dieser Rechtslage: Ist es in Ihrem Sinne, den Status einer schwangeren Person derart zu stärken, dass ihr Rechte zukommen, die den Schutz «ihres» ungeborenen Lebens auch de jure überschreiben? Anders gefragt: Lassen sich aus schwangeren Menschen mehr als «nur» Personen machen?
Vielen Dank im Voraus für eine Klärung.