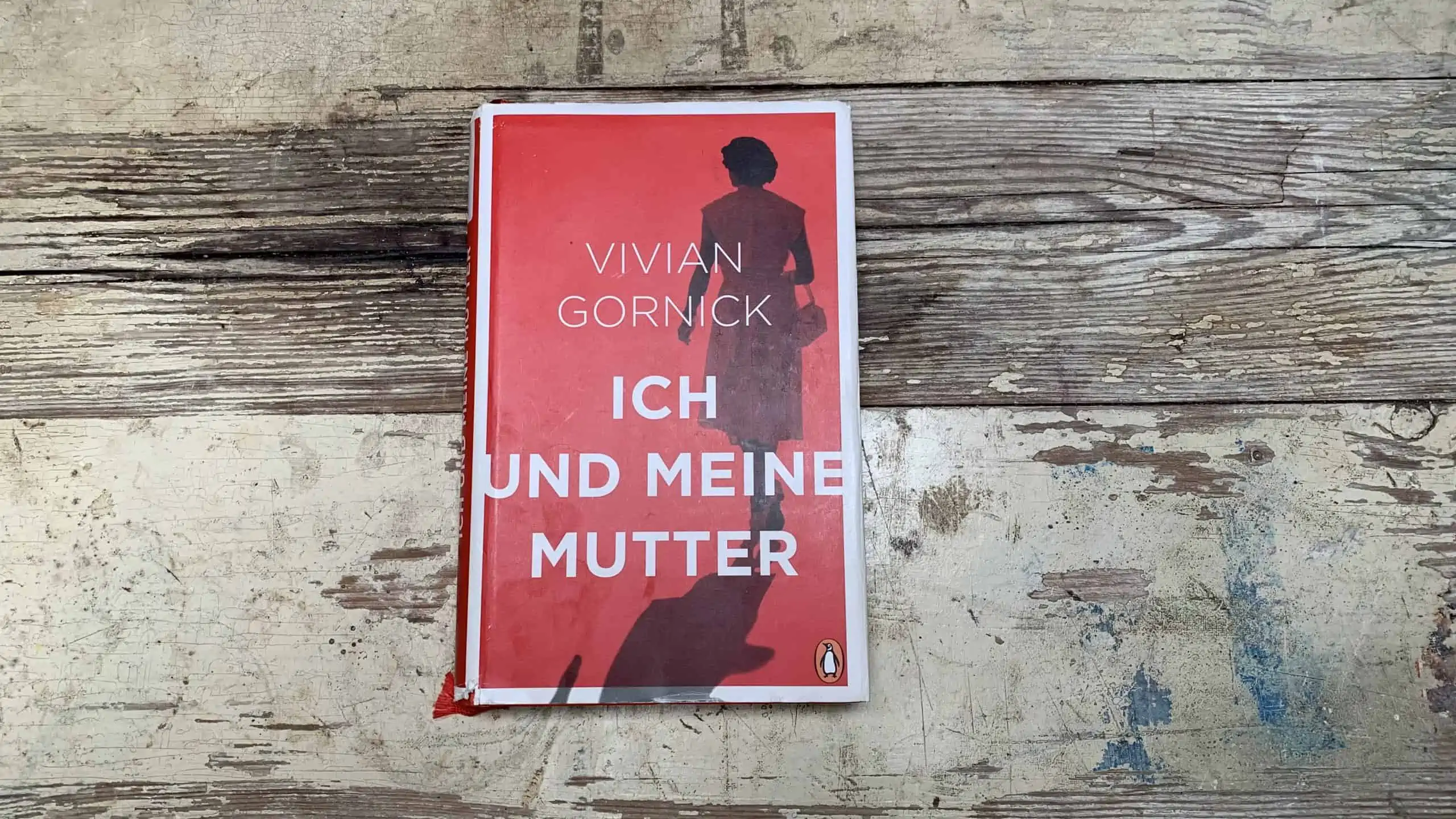Wie lassen sich künstlerische Arbeit und Muttersein vereinbaren? 1929 machte Virginia Woolf einen zukunftsweisenden Vorschlag.
Was haben Literatinnen wie George Eliot, Jane Austen, Charlotte und Emily Brontë ausser dem Verfassen von Romanen gemeinsam? «Die möglicherweise relevante Tatsache, dass keine von ihnen ein Kind hatte», bemerkt Virginia Woolf in ihrem bekannten Essay A Room of One’s Own von 1929.
Ein eigenes Zimmer und 500 Pfund im Jahr. Das sind die Bedingungen, die Frauen zum Schreiben benötigen. Virginia Woolfs Interesse galt nicht primär schreibenden Müttern. Doch in ihrem mutigen Bestehen auf der Verbindung von Kreativität und materieller Wirklichkeit blitzt eine Vision auf, in der sich künstlerisches Schaffen und Mutterschaft versöhnen lassen: «Irgendwie muss das Buch dem Körper angepasst werden». Damit formulierte sie vor knapp hundert Jahren eine ernsthafte Alternative zum Credo der Flexibilität von heute, das eine permanente Anpassung des Körpers und Geistes an die zu bewältigende Arbeit verlangt.

Zwar konnte Großbritannien schon vor dem 20. Jahrhundert eine vergleichsweise beachtliche Zahl erfolgreicher Schriftstellerinnen vorweisen. Doch wie Woolf richtig feststellte, hatten die meisten keine Kinder. Jene, die Kinder bekamen, brachen mit den Konventionen. Mary Wollstonecraft zog ihre erste Tochter allein gross. Ihre zweite, Mary Shelley, entfloh dem Vaterhaus, um mit dem bereits verheirateten Dichter Percy Shelley zusammenzuleben. Elizabeth Barrett Browning gebar ihr einziges Kind in dem damals ungewöhnlich hohen Alter von 43 Jahren. Und Doris Lessing verließ ihre ersten beiden Kinder, um schreiben zu können.
Materiell benachteiligt und von gesellschaftlichen Erwartungen erdrückt stand Frauen zudem kein künstlerisches Selbstverständnis zur Seite. Meisterwerke, so Woolf, seien keine «einsamen Geburten», sondern das Ergebnis von vielen Jahren gemeinsamen Denkens, so dass die Erfahrung vieler Menschen hinter der einzelnen Stimme steht. Während Schriftsteller sich auf die Werke und Biografien männlicher Vorbilder beziehen können, fehlten Frauen künstlerische role models. Diese hätten für Frauen auch das Verhältnis zwischen Werk und Kindern geregelt. So aber dauert bis heute das Dilemma fort: Bleibt eine Schriftstellerin kinderlos, gelten ihre Werke als Kinderersatz. Hat sie hingegen Kinder, stehen ihre Bücher angeblich in einer inniglichen Beziehung zu diesen. Ist J. K. Rowlings Harry Potter nicht der Befreiungsschlag einer alleinerziehenden Mutter? Sind Silvia Plaths Gedichte nicht das Omen des künftigen Suizids einer Mutter? Hat mit Frankensteins mutterlosem Monster Mary Shelley nicht den Tod ihres Babys verarbeitet? Egal, was Frauen künstlerisch auf die Beine stellen – es muss sich ständig die Frage gefallen lassen, in welchem Verhältnis es zu ihren (fehlenden) Kindern steht.
Egal, was Frauen künstlerisch auf die Beine stellen – es muss sich ständig die Frage gefallen lassen, in welchem Verhältnis es zu ihren (fehlenden) Kindern steht.
Woolfs feministische Perspektive will nicht an männliche Traditionen anknüpfen. Stattdessen holt sie die geistige Tätigkeit des Schreibens auf den Boden der Tatsachen zurück. Aus eigener Erfahrung weiss sie um die körperlich bedingten Unterbrechungen des Arbeitsalltags, die, wie ihre Tagebücher belegen, von Erkältungen über PMS, Zahnschmerzen bis hin zu Erschöpfungszuständen reichen. Diesen Zuständen eingedenk malt sie eine Zukunft des Schreibens aus, die dem Körper Rechnung trägt. Denn Unterbrechungen, stellt sie fest, würde es im Leben von Frauen immer geben. So also muss sich das Buch dem Körper anpassen.
Die Idee, dass die Flexibilität in der Kunstform liegt, wirkt gerade aus heutiger Sicht befreiend. Stellt sie doch einen Gegenvorschlag zu Vereinbarkeitskonzepten dar, die eine stete Justierung des Körpers, ja des ganzen Lebens zugunsten der Arbeitsform einfordern. Frei nach Woolf lässt sich die Chance auf eine bessere Vereinbarkeit auch anders denken: als ein Modell, in dem sich nicht der Körper der Arbeit, sondern die Arbeit dem Körper anpasst.
uncode-placeholder
Marlene Dirschauer
Marlene Dirschauer ist anglistische Literaturwissenschaftlerin. Sie promovierte an der Friedrich Schlegel Graduiertenschule in Berlin und an der Cambridge University zur Poetik des Wassers im Werk der englischen Schriftstellerin Virginia Woolf. Ihre Dissertationsschrift wird 2022 unter dem Titel Modernist Waterscapes. Virginia Woolf and the Poetics of Water erscheinen. Zurzeit vertritt Marlene Dirschauer eine Juniorprofessur für Anglistik an der Humboldt Universität zu Berlin und forscht zu weiblichen Darstellungen von Tod und Begehren in der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Literatur. Sie lebt mit ihren zwei Töchtern in Berlin.