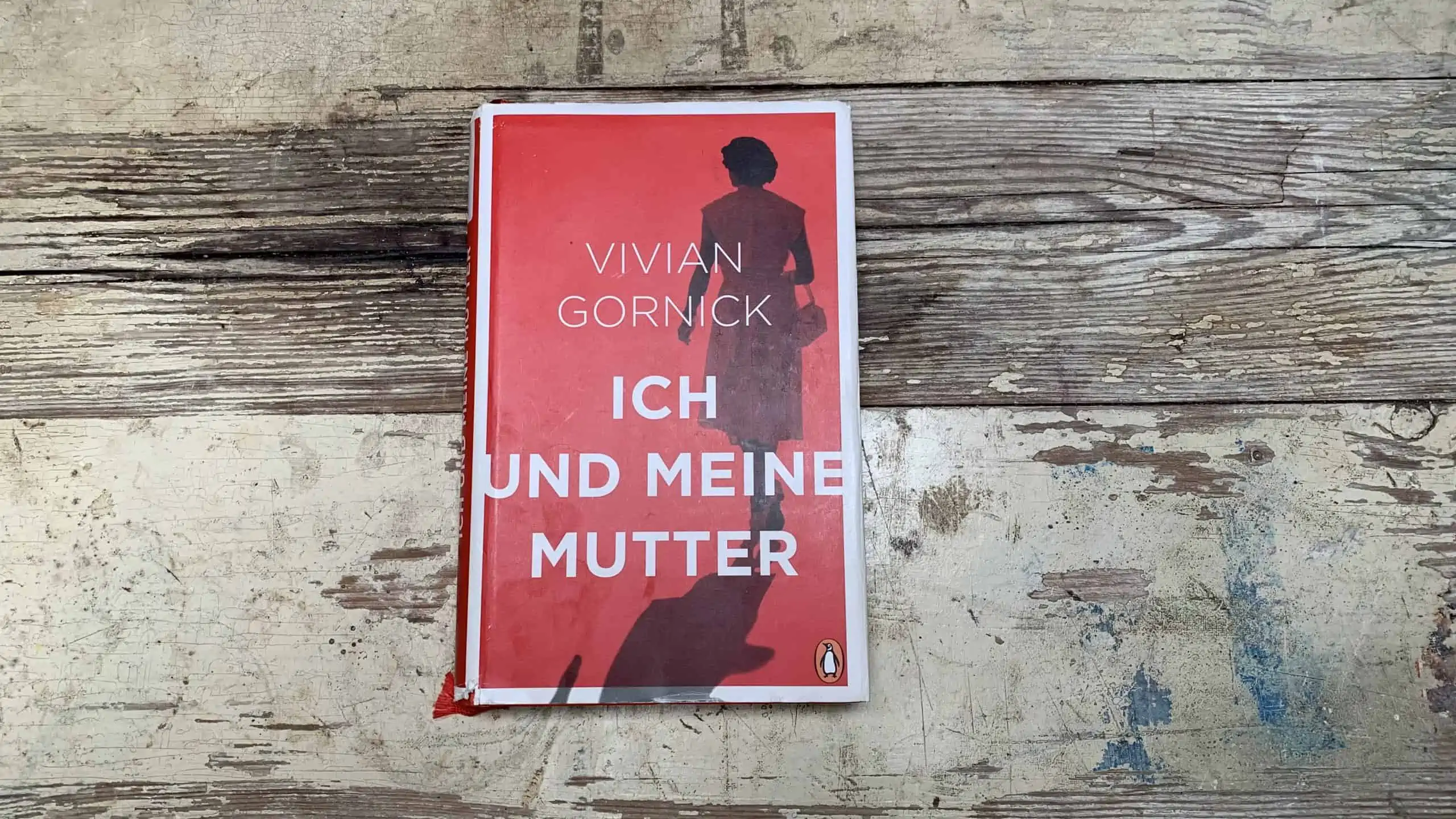Wer entscheidet, ob ich eine Schwangerschaft austrage? Wer bestimmt, ob ich Kinder bekommen darf? Seit 1994 untersagt die Agenda von Kairo den Staaten, mithilfe von Geburtenkontrolle das Bevölkerungswachstum zu beeinflussen. Stattdessen stehen sie in der Pflicht, das Wohlergehen und die Selbstbestimmung der Frauen zu fördern. Doch damit ist es nicht getan …
Für Mütter war Kinderkriegen nie Privatsache. Seit je kontrollieren und regulieren Familien, Gesellschaften und Staaten die weibliche Fruchtbarkeit. ‚Zu viele‘ oder ‚zu wenige‘ Menschen – diese Szenarien bestimmten die Geschichte der europäischen Staatenbildung. Geburtensteuerung gehörte zu den primären, oft mit Gewalt durchgesetzten Aufgaben des modernen Staates. Die „richtige“ Bevölkerungsgrösse war die Basis für die militärische, politische und ökonomische Macht eines Staates.
Bis in die jüngste Zeit hinein versuchten westliche Staaten Geburten im Globalen Süden zu kontrollieren. Sie stützten sich dabei auf einen Jahrzehnte geführten Diskurs um eine angebliche Überbevölkerung. So knüpften etwa der IWF oder die Weltbank Entwicklungshilfegelder an die Auflage, sogenannte Dritte-Welt-Länder hätten ihre Bevölkerungszahlen zu reduzieren – mit der Folge, dass in Indien Millionen von Frauen und Männern zwangssterilisiert wurden. Gegen diese Politik gab es weltweite Proteste sowohl von NGOs also auch Frauenbewegungen.
Die Agenda von Kairo
Im Jahr 1994 schaffte die UNO an der Weltbevölkerungskonferenz von Kairo die Bevölkerungspolitik offiziell ab. Nach langen Verhandlungen verabschiedete die internationale Staatengemeinschaft die Agenda für Reproduktive Gesundheit und Rechte (United Nations 1994). Mit ihr wandte man sich von einer Politik ab, die auf die Bevölkerung als Ganzes zielte, und verpflichtete sich stattdessen auf Prinzipien der individuellen Selbstbestimmung und der Gesundheitsförderung. 179 Länder stellten die Fortpflanzung auf die Basis von Menschenrechten. Von nun an wollte man für die Gesundheit der Frauen sorgen, statt deren Fortpflanzungsverhalten kontrollieren. Das Abschlussdokument hat bis heute globale Gültigkeit und dient als Richtlinie, an der sich Regierungen und NGOs orientieren (sollten). Es war zweifellos ein wichtiger Schritt, um Menschenrechtsverletzungen im Bereich der reproduktiven Freiheit zu sanktionieren.

Die Agenda von Kairo ist ein Anfang. Nicht weniger, aber auch nicht mehr: So büssten die ursprünglichen Forderungen der Frauenbewegungen einige ihrer Ziele ein. Abtreibung zum Beispiel anerkennt das Dokument nicht als Menschenrecht. Deshalb bleibt ihre Regelung bis heute den einzelnen Ländern überlassen – mit dem Resultat, dass in vielen repressiven Ländern jährlich zehntausende Frauen an unsicher durchgeführten Abtreibungen sterben und weitere sieben Millionen Frauen ins Krankenhaus gebracht werden. Ausserdem klammert die Agenda sexuelle Rechte und Selbstbestimmung aus, darunter das Recht auf sexuelle Unversehrtheit oder auf freie Partner*innenwahl unabhängig von Geschlechtsidentität, Sexualität usw.
Antinatalismus wurde mit Gesundheitsargumenten legitimierbar.
Vor allem aber öffnete das Dokument der staatlichen Geburtensteuerung doch noch eine Hintertür. Verschiedene Forscherinnen haben gezeigt, dass die Agenda eine Transformation und weniger eine Abschaffung oder gar ein Ende der Bevölkerungspolitik war. Zahlreiche Programme halten Frauen im Globalen Süden an, weniger Kinder zu kriegen, weil es für sie gesünder wäre (Schultz 2006). Anders ausgedrückt: Antinatalismus wurde mit Gesundheitsargumenten legitimierbar. Indem Kairo Fortpflanzung zum Public-Health-Thema machte, blieb die Agenda weiterhin für geburtensteuernde Politik anschlussfähig. Fortgeführt wurde damit eine alte Politik im neuen Kleid: Wie bringt man Frauen dazu, Fortpflanzung zwar frei und selbstbestimmt, aber gesundheitlich und demographisch optimal zu managen?
„It’s your choice“
Im Gegensatz zu früheren repressiven Politiken überantwortet Kairo die Aufgabe der Geburtenkontrolle vom Staat auf die Frau. Sie erhält zwar das Recht, nach eigenem Willen Kinder zu kriegen, doch zugleich muss sie sich darum bemühen, es auch „richtig“ zu machen. Die Betonung der Eigenverantwortung lässt sich leicht mit der paternalistischen Idee verbinden, wonach bestimmte Frauen (‚Dritte-Welt‘-Frauen) optimale reproduktive Verhaltensweisen erst erlernen müssen.
Der Fokus auf individuelle Verhaltensweisen stellt Verhütung und Verhütungsmittel in den Vordergrund. Doch damit gerate sozioökonomischen Bedingungen von Fortpflanzung oder asymmetrische Geschlechterverhältnisse aus dem Blick. Viele Entwicklungshilfeprojekte konzentrieren sich entsprechend auf die Aufklärung, wie sich optimal zeugen und verhüten lässt, vernachlässigten aber Herausforderungen wie die Verbesserung von Gesundheitsversorgung, den Bau von Krankenhäusern oder den Zugang zu Geburtshilfe.
Statt von Rechten ist von Choice die Rede.
Die Agenda von Kairo wurde im Jahr 2001 durch die WHO für den europäischen Raum spezifiziert und konkretisiert. Ihr Titel: Regional Strategy on sexual and reproductive health (WHO Regional Office for Europe 2001). In meiner Dissertation habe ich gezeigt, dass die europäischen Programme das individuelle Gesundheitsverhalten noch zusätzlich betonen: Gesundheit, Gesundheits-Know-How und Gesundheitsverhalten stehen nun ganz im Zentrum. Politische Rechte sind kaum mehr Thema (auch nicht mehr im Titel). Statt von Rechten (wie in der Kairo-Agenda) ist im gesamten Dokument von Choice (Wahlfreiheit) die Rede.
Der Begriff Choice stammt aus der US-amerikanischen Frauenbewegung der 1960er-Jahre, die mit der Devise Pro-Choice die reproduktive Selbstbestimmung der Frauen forderte, darunter vor allem das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, aber auch die freie Wahl im Bereich der Verhütung. Der Claim My Body, My Choice brachte die liberalen Ideen von Selbstbestimmung und Entscheidungsfreiheit auf den Punkt und machte die Bewegung auch einem grossen Publikum bekannt. Den größten politischen Erfolg erzielte die Frauenbewegung – noch bevor Pro-Choice zu einer gut organisierten internationalen Bewegung wurde – mit der Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen 1973 in den Vereinigten Staaten.

Verwendet die internationale Politik feministische Begriffe, bringt das Probleme mit sich: Wie wird eigentlich Choice gefasst? Wer definiert, was eine selbstbestimmte Entscheidung einer Frau ist und was nicht? Und wie werden einst kämpferische Forderungen wie reproductive Choice geschwächt, wenn sie von der offiziellen Politik übernommen werden?
Die Programme suggerieren, der Zugang zu sowie Nutzung von Verhütungsmitteln seien die entscheidenden Indizien für ‚Selbstbestimmung‘.
Die UN-Programme verwenden „Choice“ tatsächlich als eine abgeschwächte und entpolitisierte Variante von Rechten. Reproduktive Selbstbestimmung wird lediglich als eine ‚Verhütungs-Wahl‘ definiert, die auf der Grundlage sachkundigen Verhütungswissens vor dem Eintreten einer Schwangerschaft getroffen wird. Die WHO Europa beruft sich dabei auf einen quantitativen Ansatz: Je verschiedener und je zugänglicher Verhütungsmittel sind, desto eher werden sie verwendet: „Indeed, evidence shows that offering a choice of methods leads to greater use of contraception“ (WHO 2013: 4). Die Programme suggerieren, der Zugang zu sowie die erhöhte Nutzung von Verhütungsmitteln seien die entscheidenden Indizien für ‚Selbstbestimmung‘ und mithin Ausdruck einer besseren reproduktiven Gesundheit.
Schwangerschaft ist keine „Wahl“
Wer wie der europäische Zweig der WHO Choice als Verhütungswahl begreift, nimmt vier Nebenwirkungen in Kauf, welche die Freiheit reproduktiven Handelns massiv begrenzen und wichtige Dimensionen von Selbstbestimmung ausblenden:
Indem die Programme erstens die Selbstbestimmung bzw. Choice auf den Zeitraum vor dem Eintreten einer Schwangerschaft festlegen, ist letztere selbst nicht mehr Gegenstand einer freien Wahl. Schwangerschaftsabbrüche gelten folglich nicht mehr als Ergebnis einer Entscheidung. Eine so verengte Perspektive blendet aus, dass es selbst bei einem flächendeckenden Verhütungsmittelangebot weiterhin zu ungewollten Schwangerschaften kommt. Dementsprechend fällt die Notwendigkeit, Abtreibungsmöglichkeiten bereit zu stellen, in den Choice-Konzepten der WHO unter den Tisch.
Durch den Fokus auf Verhütung wird Choice zweitens auf einzelne, leicht messbare Faktoren wie den Zugang zu Verhütungsmitteln reduziert. Aus dem Blick gerät, welche Voraussetzungen wie Gleichstellung oder ausreichende Gesundheitsversorgung es braucht, damit verschiedene Frauen auch tatsächlich eine freie Wahl haben.
Drittens zeigt sich auch in den WHO-Konzepten ein tendenziell paternalistischer Ton, der nahelegt, Frauen, aber auch Männer würden erst durch diese Programme überhaupt in die Lage versetzt, richtige, gesunde und mithin selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Wie es die WHO formuliert:
„People should be enabled, through information and education, to acquire and maintain behaviour that promotes their own reproductive health“ (2001: 16). Die Länder wiederum werden folglich dazu angehalten, „[to] ensure that
women receive the information they need to make informed decisions“ (WHO 2013: 11).
Mit anderen Worten: Selbstbestimmt kann das Handeln von Frauen nur dann sein, wenn es den programmatischen Idealen der reproduktiven Gesundheit entspricht.
Der hohe Stellenwert von Verhütung und Verhütungsverhalten rückt viertens Entscheidungen ins Zentrum, die auf Planung basieren. Die Entstehung von Kindern erscheint als ein durch und durch intentionaler und rationaler Prozess. In der Perspektive der WHO-Programme meint Choice die richtige Planung von Schwangerschaften mit dem Ziel, dass, wie die WHO schreibt, jedes Kind ein gewolltes Kind ist (WHO 2001, 8). Zugrunde gelegt wird ein „positivistisches Verständnis von Autonomie“ (Hirschauer 2014), das ‚gewollt‘ und ‚geplant‘ gleichsetzt. Unbeachtet bleibt, dass sich eine ungewollte auch in eine gewollte Schwangerschaft verwandeln kann. Wie Hirschauer zeigt, kann, was „plötzlich passiert ist“, einige Zeit später den Anstrich eines langfristigen Planes bekommen – oder umgekehrt: Eine geplante Schwangerschaft kann sich plötzlich in eine ungewollte verwandeln. Die starke Unterscheidung von ‚geplant‘ und ‚ungeplant‘ entspricht keiner gelebten Praxis.
Die Unterscheidung von ‚geplant‘ und ‚ungeplant‘ entspricht keiner gelebten Praxis.
Letztlich vergisst die Choice-Perspektive der WHO, dass der biografische Übergang zur Elternschaft oftmals kaum mit dem klassischen Modell rationaler Entscheidung übereinstimmt. Elternschaft „kann sich ereignen, ohne dass eine Entscheidung getroffen wurde“ – allerdings bedeutet das eben nicht zwangsläufig, dass eine Schwangerschaft ungeplant oder ungewollt war.
Eine „Wahl“ haben nicht alle
Bei genauerer Betrachtung wird Choice, so wie es die Programme verwenden, vielen Frauen und Lebenssituationen nicht gerecht. Die Aktivistinnen von Sister Song zum Beispiel, einem Zusammenschluss von Frauen aus afrikanischen Ländern, kritisierten, dass die Lebenssituationen von Women of Color im Choice-Konzept nicht berücksichtigt werden. Choice blende die ökonomische Ungleichheit aus, von der Women of Color sowohl in der westlichen Hemisphäre als auch in den Ländern des Globalen Südens besonders häufig betroffen sind.
Laut Sister Song ist Choice vor allem in der politischen Rhetorik weißer Frauen der amerikanischen Mittelklasse beheimatet. Diese haben durch ihren sozialen Status bereits eine Auswahl an Möglichkeiten, etwa darüber zu entscheiden, ob und wann sie Mütter werden wollen oder nicht. Arme, wenig privilegierte Frauen seien von einer solchen Wahl oft weit entfernt und vielfältigen Zwängen unterworfen.
Die Kritik am Choice-Konzept ist auch eine Kritik an einer neoliberalen Entscheidungsautonomie, in der Menschen angeblich zwischen einer Vielfalt von Optionen frei wählen können. Das Ideal der Wahlfreiheit klammert die gesellschaftlichen Bedingungen aus, unter denen Entscheidungen überhaupt getroffen werden (können). Für Frauen, die keinen Zugang zu Abtreibung, Gesundheitsversorgung und überhaupt zu würdigen Lebensoptionen haben, entfernt sich die Idee der Wahl so weit von der Realität, dass sie zu einem hohlen Konzept verkommt. Ausserdem kann nicht ernsthaft von einer „Wahl“ gesprochen werden, wenn Staaten wie die USA Frauen mit Drogenproblemen oder einer kriminellen Vergangenheit bestimmte Verhütungsmittel aufzwingen, indem sie ihnen ‚Boni‘ versprechen oder die Sozialhilfe kürzen, wenn die Frauen sich weigern, die Verhütungsmittel einzunehmen.

Ein Recht auf Familie
Viele Frauen sind als Mütter in dieser Gesellschaft nicht vorgesehen. Sie müssen nicht darum kämpfen, zu verhüten, um nicht Mutter zu werden. Vielmehr streiten sie dafür, unter widrigen Umständen überhaupt Mütter sein zu dürfen und ihre Kinder würdevoll grosszuziehen. In Bezug auf die Frage, was denn eigentlich reproduktive Selbstbestimmung sei, müssen wir berücksichtigen: Für privilegierte Frauen ist Familie oft ein Ort der Enge und Einschränkung. Familie und Kinderkriegen stehen hier oft im Gegensatz zu bestimmten feministischen Autonomieidealen, sie sind mit dem Druck konfrontiert, perfekte Mütter sein zu müssen, weshalb ihre Emanzipation eher darin besteht, sich von Familiennormen zu emanzipieren. Doch für weniger privilegierte Frauen kann Familie ein Ort des Widerstandes sein: Diese wurde ihnen im Zuge von Sklaverei, Migration oder Diskriminierung oftmals verweigert. Ihr emanzipatorisches Anliegen besteht darin, überhaupt als Mütter anerkannt zu werden und sozioökonomische Bedingungen zu schaffen, unter denen sie Kinder großziehen können.
Sister Song fordert, das Recht auf Familie genauso wie die Freiheit zur Verhütung zu gewichten. Doch damit Frauen dieses Recht wahrnehmen können, bedarf es einer sozialen Gerechtigkeit, die alle Elemente von reproduktiver Selbstbestimmung und Elternschaft berücksichtigt. Sister Song nennt das: reproductive justice.
Loretta Ross, Mitgründerin von Sister Song, schreibt:
„Speaking of causes in common, we have to fight for the right to parent the children that we have. So when you talk about reproductive struggle, realize it’s a three-way struggle: It’s not just about the right to abortion and contraception. It’s about the right to live a life based in human rights, a right to live life the way we choose, but also […] not only the life we choose, but to have the social supports necessary to live that life we choose, cause having choices without enabling conditions to exercise those choices doesn’t make sense.“
„having choices without enabling conditions to exercise those choices doesn’t make sense“ Loretta Ross
Literatur
Hirschauer, Stefan. 2014. Soziologie der Schwangerschaft. Stuttgart
Schultz, Susanne. 2006. Hegemonie – Gouvernementalität – Biomacht. Reproduktive Risiken und die Transformation internationaler Bevölkerungspolitik. Münster.
UN. 1994. Programme of Action adopted at the International Conference on Population and Development Cairo, 5–13 September 1994. Online
WHO Regional Office for Europe. 2001. WHO Regional Strategy on sexual and reproductive health. Copenhagen. Online
WHO. 2013. Entre Nous. The European Magazin for Sexual and Reproductive Health. Copenhagen. Online
Bildnachweis
Rice Toasties Printwerbung aus den 1950-Jahren.

uncode-placeholder
Franziska Schutzbach
Franziska Schutzbach ist Geschlechterforscherin, Soziologin und Publizistin. Sie ist feministische Aktivistin und Mutter von zwei Kindern. In ihrer Dissertation Politiken der Generativität. (2020) analysierte sie internationale Programme zu reproduktiver Gesundheit und ihr Einfluss auf gegenwärtige Vorstellungen von Heteronormativität. Ebenfalls von ihr erschienen: Die Rhetorik der Rechten (2019).