Mütter sind Stoff für Traumata. Und wohl kaum eine Mutter eignet sich dafür besser als die „jiddische Mamme“. Nachdem Frauen wie Getrude Berg diese als Figur für die Populärkultur fit gemacht haben, arbeiten sich eine Generation später die Söhne wie Philip Roth oder Woody Allen an ihr ab. Versöhnlicher nähern sich inzwischen Töchter wie Gayle Kirschenbaum ihren Müttern an …
Die jüdische Mutter, die ihre Kinder kontrolliert, manipuliert und dabei alle Schamgrenzen überschreitet, gehört in den USA zu den bekanntesten Stereotypen. Dieser stock character wurzelt in der Geschichte der jüdischen Einwanderer*innen New Yorks. Sie flohen aus den osteuropäischen Shtetln in die Neue Welt, auch wenn sie da auf eine nicht minder elende Lebenswirklichkeit trafen. Hier wie dort erhielten die Mütter ihre Familien wirtschaftlich und sozial am Leben. Dabei verschwammen häufig die Grenzen zwischen Sorge um und Kontrolle über die eigenen Kinder. Dan Greenburgs „Manual“ How to Be a Jewish Mother (1964) informiert in ironisch-satirischer Form über die „basic techniques“ der Mütterlichkeit. In deren Mittelpunkt stand das kindliche Schuldbewusstsein: „Control guilt and you control the child“ (Greenburg 1964:13).
Die jüdische Mutter erobert die US-amerikanische Popkultur und Literatur in der Zwischenkriegszeit. Die Entertainerin Sophie Tucker (1887–1966) besingt im Lied My Yiddishe Momme das harte Leben und die hingebungsvolle Sorge um die Kinder. Doch der darin gepriesene „sweetest angel“ weicht immer mehr der Mamme „with a finger in every pie“. Bespielhaft wird diese in der Figur der Molly Goldberg verkörpert, Protagonistin der Hörspiel- und späteren Fernsehserie The Goldbergs, die von 1929 bis 1955 ausgestrahlt wurde. Die Sitcoms der folgenden Jahrzehnte erfanden für sie zahlreiche Nachfolgerinnen.
Obsession
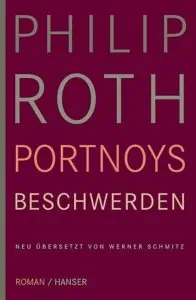
Eine Generation später legen sich die Söhne der jüdischen Mamme auf die Couch. In Philip Roth‘ Portnoy’s Complaint (1969) offenbart sich Alexander Portnoy seinem Analytiker Dr. Spielvogel: Im Mittelpunkt steht natürlich seine Kindheit mit einer aufopferungsvollen, gleichzeitig aber dominanten und übergriffigen Mutter. Während der Vater unter Verstopfung leidet, rebelliert der Sohn mit obsessiver Sexualität. Seine Vorliebe für nicht-jüdische „Schicksen“ löst ihn einerseits von seiner Mutter ab, anderseits binden ihn die Schuldgefühle nur noch enger an sie.
Filme greifen Roth‘ wirkmächtiges Mutterbild auf: In Oedipus Wrecks (1989) spielt Woody Allen den New Yorker Anwalt Sheldon Mills, der aufgrund seiner Mutterbeziehung ein neurotisches Dasein fristet. Auch er ist zunächst mit einer „Schickse“ liiert und verhandelt seine Probleme in therapeutischen Sitzungen. Deren Erkenntniswert ist allerdings zweifelhaft: Sheldon verliebt sich in seine Analytikerin und steigert damit letztlich sein Mutterproblem. Die Unmöglichkeit, der mütterlichen Obhut zu entkommen, wird überdeutlich als Mrs. Mills als gigantisches Über-Ich an New Yorks Himmel erscheint und den Sohn vor allen Passant*innen bloßstellt. Die Szene gemahnt nicht nur an das vermutlich jüdische Sprichwort: „Weil Gott nicht überall sein konnte, hat er die Mütter erschaffen“. Vielmehr verweist sie auf absurd tragische Weise auf das intergenerationelle Trauma des Exils, in das Eltern und Kinder gleichermaßen verstrickt sind.

Kastration
Roths und Allens Einfluss lässt sich auch im deutschsprachigen Kontext ausmachen. Beispiele dafür sind die Romane Die jiddische Mamme (1990) von Rafael Seligmann und Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse (2012, Verfilmung 2018) von Thomas Meyer. In beiden wiederholt sich die Konstellation des jüdischen Mannes, der „Schicksen“ begehrt.
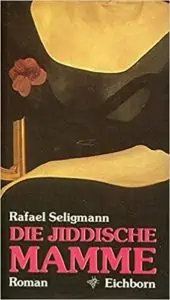
Seligman lässt den Studenten Samuel Goldmann eine deutsch-israelische Abenteuerreise unternehmen, die im wahrsten Sinne des Wortes über verschiedene (jüdische und nichtjüdische) Frauenkörper führt. Eine Badeszene zu Beginn des Romans offenbart den ödipalen Ursprung dieser Odyssee. Sie lotet den Bereich frühkindlicher Sexualität bis an und über seine Grenzen aus. Später konkretisiert Samuels Tante die inzestuösen Spiele: Sie gewährt ihrem „Jingele“ alles – bis auf die Penetration: „Sie wollte alles haben – außer meinen Schmock im Schoß“ (1990:41).
Die pathologischen Gegensätze von Begehren und Kontrolle, Zurückweisung und Nähe bestimmen die Beziehungen zwischen Samuel, seiner Mutter und seiner Tante. Jeder Versuch, diesen „Ödipuskomplex“ (Freud 1923: 36f.) zu überwinden, kann nur in weiteren Frauenbeziehungen münden. Eine Psychoanalyse schlägt fehl, weil sich der ewige Sohn nicht gegen seine Mamme aufhetzen lassen will. Samuels Ehe mit einer sephardischen Israelin gerät schließlich zum Zerrspiegel seines Mutterkomplexes: „Du bist meine weiche, alberne Diaspora-Samuela“, lässt Sara ihren Ehemann nach der Trauung wissen. Damit kastriert sie ihn verbal; der Protagonist kann darauf nur noch dankbar ergeben erwidern: „Ja, Mamme“ (1990:244).
Emanzipation
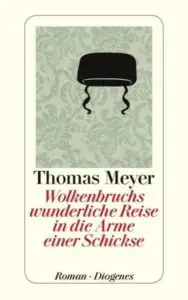
Während Samuel symbolisch in den Mutterschoß zurückkehrt, entgeht Mordechai „Motti“ Wolkenbruch diesem Schicksal. Im Roman Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse versucht der Held den Eheschliessungsplänen seiner Mutter zu entkommen, die sie mit Kontrolle und knajdlech (jidd. Knödel) durchzusetzen trachtet – unterstützt von zahlreichen Gleichgesinnten der Züricher Gemeinschaft. Die „jüdischen Manipulationskünste“ sind, davon ist Motti überzeugt, eine weibliche Disziplin mit direkter Erbfolge:
„Musste meine Mutter aufwendigste Ränkespiele drechseln, um ihre Umgebung gefügig zu machen, genügte meiner Großmutter ein kaum merkliches Schulterzucken oder eine minimal wegwischende Geste, um sämtlichen Personen im Umkreis von finfzig (jidd. fünfzig) Metern eine Jahresdosis schlechtes Gewissen zu verpassen“ (Meyer 2012:75).
Der von zahlreichen Jiddismen durchzogene Text verdichtet die Mamme zu einer tragisch-komischen Gestalt, zur Karikatur der im traditionellen Judentum verehrten „Hüterin des Hauses“ (Herweg 1995:157). Ihrer Sorge um die mischpuche (jidd. Familie) vermag sie nur noch über eine Mélange aus Überfürsorge und Schuld Ausdruck zu verleihen.
Die Mutter verkörpert aus der Perspektive des Sohnes das matrilineare Judentum: Mit ihr zu brechen, ist Verrat an der eigenen religiös-kulturellen Herkunft. Die „Schickse“ hingegen wird in diesen (männlich erzählten) Mutter-Sohn-Konstellationen zur verlockenden Anderen. Sie verspricht nicht nur die sexuelle, sondern auch die tatsächliche Befreiung von den mütterlichen Fesseln und den Regeln der jüdischen Gemeinschaft.
Versöhnung
Die Beziehung der Tochter zu ihrer Mamme ist nicht weniger komplex. Die Dokumentarfilmerin und Produzentin Gayle Kirschenbaum lotet in ihren Kurzfilm My Nose (2007) und dessen Erweiterung und Fortsetzung Look at Us Now, Mother! (2016) das Dreiecksverhältnis zwischen ihrer Nase, ihrer Mutter und sich selbst aus. Kirschenbaum lässt ihre Nase in verschiedenen Schönheitskliniken begutachten, gleichzeitig bittet sie Passant*innen um ein Urteil. Dabei wird nicht nur ihre Nase vermessen, sondern auch die Beziehung zu der distanziert-kühlen Mutter. Diese rät schon dem Teenie zu einem „nose job“, also zu einer Nasenkorrektur (Rhinoplastik).
Dieser therapeutisch-künstlerische Ansatz bricht mit der misogyn grundierten Perspektive männlicher Autoren und Regisseure.
Kirschenbaum wächst als Jüngste von drei Kindern und einziges Mädchen auf. Ihrer Mutter, die sich einen weiteren Sohn gewünscht hatte, bleibt sie fremd. Das Trauma ihrer lieblosen Kindheit kulminiert in dem kritischen Blick der Mutter auf ihre Nase, die zum Synonym wird für die Ablehnung nicht nur ihrer Tochter, sondern einer weiblich-jüdischen Nachkommenschaft. Die zaghafte Annäherung der beiden Frauen mündet in einem knapp zehn Jahre später veröffentlichten Langfilm Look at Us Now, Mother!, der Bestandteil eines von Kirschenbaum initiierten „Forgiveness Projects“ ist. Letzteres widmet sich der Wiederherstellung relevanter Beziehungen („Restoring Relationships that Matter“) und umfasst diverse TED Talks, Coaching- und Workshop-Angebote. Dieser therapeutisch-künstlerische Ansatz bricht mit der misogyn grundierten Perspektive männlicher Autoren und Regisseure. Empathie und Pathos sind Kirschenbaums Mittel, um ein intergenerationelles Trauma aufzubrechen.
Fazit
Die Figur der übergriffigen und omnipotenten Mamme, welche die ganze Familie zusammenhält, ist zunächst keine Männerfantasie, sondern vielmehr ein kulturelles Konstrukt, entstanden in der US-amerikanischen Zwischenkriegszeit. Die intendierten und nicht-intendierten Nachwirkungen dieses stock characters werden erst eine Generation später virulent. Die echten und fingierten Söhne versuchen mehr oder weniger erfolgreich dem Klammergriff zu entkommen, indem sie sich in die Arme von nichtjüdischen Frauen retten und – verfolgt von Schuldgefühlen – ein „Zerrbild“ (Ludewig 2012:58) ihrer Mütter entwerfen. Dass Flucht nicht der einzige Ausweg ist, zeigen die Versöhnungsbemühungen von Töchtern wie Gayle Kirschenbaum.
Abschließend bleibt festzustellen, dass dieses Mutterstereotyp nicht auf jüdische Lebenswelten beschränkt, sondern insbesondere in Emigrantenfamilien zu beobachten ist. Ein Beispiel ist die erfolgreiche Liebeskomödie My Big Fat Greek Wedding (Zwick 2002). In diesem Sinne meint bereits Greenburg:„You do not have to be Jewish to be a Jewish mother, but it helps“ (1964:145). Die jüdische Diaspora und Verfolgungsgeschichte haben freilich zu spezifischen Ausprägungen und einer wohl einzigartigen Verschränkung von psychoanalytischen und künstlerischen Narrativen geführt.
Literatur
Freud, Sigmund. 1923. Das Ich und das Es. Leipzig/Wien/Zürich.
Greenburg, Dan. 1964. How to be a Jewish Mother. A very lovely training manual. Los Angeles.
Herweg, Rachel Monika. 1995. Die Jüdische Mutter. Das verborgene Matriarchat. Darmstadt.
Meyer, Thomas. 2012. Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse. Zürich.
Ludewig, Anna-Dorothea. Das Bild der Jüdischen Mutter zwischen Schtetl und Großstadt. In: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 64 (1), 2012, S. 48–58.
Seligmann, Rafael. 1990. Die jiddische Mamme. Frankfurt/M.
Bildnachweis
Bird’s Custard Powder. Britische Printwerbung aus den 1950-Jahren.

uncode-placeholder
Anna-Dorothea Ludewig
Anna-Dorothea Ludewig ist promovierte und habilitierte Literaturwissenschaftlerin am Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam, Lehrbeauftragte an der Universität Potsdam sowie Redaktionsmitglied der Online-Zeitschrift MEDAON. Ihre Habilitationsschrift „Jüdinnen“ – Literarische Weiblichkeitsentwürfe im 20. Jahrhundert wird im kommenden Jahr bei De Gruyter erscheinen.




