Liebe und Romantik seien ohne Kapitalismus nicht zu begreifen. Das behauptet die Soziologin Eva Illouz in ihrem Buch Konsum der Romantik (2014). Die Logik des Konsums und ökonomischen Handelns durchdringe immer mehr die Liebe, Partnerwahl und ‑werbung. Ein Phänomen, bei dem das deutlich wird, sind die sogenannten Pickup-Artists.
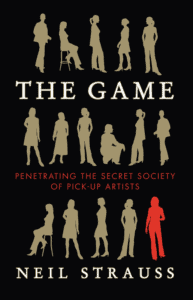
Mit dem Begriff Pickup wird eine vorwiegend männlich geprägte Subkultur bezeichnet, die sich zum Ziel gesetzt hat, Wissen über erfolgversprechendes Flirtverhalten zu sammeln, verfügbar zu machen und weiterzugeben. Erfolgreiches Flirten meint, einen anderen Menschen kennenzulernen und – je nach Absicht – mit ihm zu schlafen, kurz: ihn „aufzugabeln“ (engl. to pick sb. up). Als Pickup-Artists bezeichnet man Personen, die vermeintlich über das hierfür nötige Wissen verfügen und entsprechende Techniken beherrschen. Sie sind die Hohepriester einer ominösen Szene, die sich vorwiegend über das Internet organisiert. Diese besteht aus meist jungen Männern, die aus verschiedensten Motiven ihren Weg zu Pickup gefunden haben und hoffen, in die geheime Kunst der Verführung eingeweiht zu werden.
Die Kunst des Aufreißens präsentiert sich als Expertenwissen. Selbst zertifizierte Profis bieten es in Büchern, Seminaren oder individuellen Beratungen an. Über Bloggs und Youtube-Kanäle geben sie eine Mischung aus Tipps und Meinungsstücken über das zeitgenössische Liebes- und Sexualleben zum Besten. Die Ideen und Konzepte reichen von harmlosen Flirttipps bis zu einer politisch brisanten Mischung aus Neoliberalismus und Männerrechtsdiskursen.
Doch was motiviert junge Männer, sich Pickup zuzuwenden? Viele Adepten versprechen sich eine Metamorphose von einem Beta- zu einem Alpha-Mann. Betas werden in der Szene Männer genannt, die die Ideale der progressiv-modernen Gesellschaft verinnerlicht haben. Derart zivilisiert und verweiblicht werden sie, so die Pickup-Lehre, hart von der Wirklichkeit bestraft. Und die bestehe eben darin, dass Frauen und andere Männer zu den starken und autonomen Alphas hochschauten.
Der Begriff Alpha-Wolf taucht erstmals in Rudolf Schenkels Arbeit (1947) zum Verhalten von Wölfen in Gefangenschaft (Basler Zoo) auf. Schenkel beobachtete die Herausbildung einer Hackordnung, deren Spitze sich eine Wölfin und ein Rüde teilen. 1970 publizierte David Mech, ebenfalls Verhaltensforscher, seine Monographie The Wolf: Ecology and Behavior of an Endangered Species. Darin griff er auf Schenkels Terminologie und Befunde zurück. Das Buch erschien 1981 als Taschenbuch und erreichte eine Gesamtauflage von 120’000 Exemplaren.
Langjährige Studien mit freilebenden Wölfen veranlassten Mech in den späten 1990er-Jahren, die Befunde zu revidieren. Die Alpha-Wölfe waren nichts anderes als Eltern-Wölfe, die ihre Jungen anführten.
Gedemütigte Beta-Männer
Die jungen Männer, die sich an Pickup wenden, fühlen sich häufig enttäuscht und gedemütigt – von der Gesellschaft, der Moderne, vor allem aber von Frauen. Zuweilen mischt sich unter den Frust eine gehörige Portion Verschwörungstheorie: Frauen seien dabei, ein Matriarchat zu errichten. Nur ihr geheimer Wunsch nach Unterwerfung bremse ihre Herrschsucht. Trotz Emanzipation verfallen sie, so der Pickup-Mythos, in die ihnen vorbestimmte Rolle. Eigentlich bevorzugten sie Alpha-Männer, da sie selbst unter der Erosion klarer Rollenverteilung und dem Aufbrechen der Heteronormativität litten.
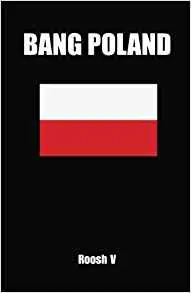
Die Kränkungsempfindungen innerhalb der Pickup-Community verlaufen analog zu Degradierungserfahrungen, wie sie derzeit in der politischen Landschaft zuhauf anzutreffen sind. Franziska Schutzbach (2017) sieht Pickup daher als eine Art Einstiegsdroge in neu- und alternativrechte Milieus. Ein deutlicher Beleg für diese These ist vor allem der rechtskonservative Blogger und Maskulist Daryush Valizadeh, der in der Szene als Roosh V bekannt ist. Valizadeh fordert die Rücknahme diverser Errungenschaften der Emanzipation. Aufmerksamkeit erregte er durch die Forderung, Vergewaltigung straffrei zu machen.
Im Dunstkreis von Maskulismus, Anti-Feminismus, neu- und alternativrechter Diskurse findet sich ein fruchtbares Milieu für die wachsende Wut auf Errungenschaften der sozialen Moderne – mit klaren Feindbildern.
Der Soziologe und kritische Männlichkeitsforscher Michael Kimmel hat in seinem Buch Angry White Men (2016) derartige Gefühlslagen als „kränkende Enteignung“ bezeichnet. Sein Beispiel sind die weißen Männer in den USA. Diese hätten verstärkt das „Gefühl, dass unsichtbare Kräfte, die größer und mächtiger sind als sie, ihnen Vorteile weggeschnappt haben, die ihnen zustehen“ (Kimmel 2016: 35). Ausgerechnet Donald Trump kam mit dem Versprechen an die Macht, diese Vorteile und die alte Welt wiederherzustellen. Damit spiegelt die amerikanische Parkettpolitik die Mikropolitik in vielen Subkulturen: Von Flirt-Techniken erhoffen sich die jungen Männer nicht nur kurzweiligen Erfolg bei Frauen, sondern auch die Wiedererlangung einer gestohlen geglaubten Souveränität. Die Erzählung von Pickup gibt den „unsichtbaren Kräften“ ein weibliches Gesicht.
Von Flirt-Techniken erhoffen sich die jungen Männer nicht nur Erfolg bei Frauen, sondern auch die Wiedererlangung einer gestohlen geglaubten Souveränität.
Neoliberale Ermächtigungsspiele
Der Rückgewinn an männlicher Souveränität bewerkstelligt Pickup mit Mitteln, die zuhauf in neoliberalen Therapiekontexten zur Anwendung kommen: Selbstüberwindung, Selbstoptimierung und Rhetoriktraining. Zu Beginn eines Trainings müssen die Jünger ihre Ängste überwinden, hier: Frauen anzusprechen. Daneben sollen sie lernen, den öffentlichen Raum als ihr Jagdrevier zu begreifen. Denn die Öffentlichkeit sei für den Beta ein reiner Transitraum, wo er in der Masse verschwindet.
In den Videos des englischen Pickup-Artists Tom Torero etwa werden junge Männer mit versteckten Mikrofonen und ihrem Lehrmeister im Ohr auf die Straße entsandt. Zunächst holprig und unbeholfen gewinnen sie schnell an Sicherheit und haben auch bald die ersten Telefonnummern eingesammelt. Wer mehr erreichen will, muss Toreros Buch kaufen.
Pickup funktioniert im Gleichklang mit den Idealen des Neoliberalismus. Die Antworten auf jedwede Krise sind Selbstoptimierung und Fehlerbehebung. Der Internetpionier und Big-Data-Kritiker Evgeny Morozov nennt das gesellschaftlich verankerte wahnhafte Streben nach Verbesserung „Solutionsimus“ (2013: 25). Für alles gibt es eine Lösung oder eine App. Die neoliberale Gesellschaft ist insofern smart, als sie alle Probleme – selbst soziale und politische – technisch löst.
In zweifacher Hinsicht basiert Pickup dabei auf einer Variante der Spieltheorie. Einerseits sind Probleme keine Probleme, sondern Herausforderungen, die sich im wortwörtlichen Sinne spielerisch lösen lassen. Die Lösung ist nur eine Frage nach der richtigen Kombination von Regeln oder Algorithmen. Andererseits modelliert die Pickup-Metaphorik Frauen zu Reiz-Reaktions-Maschinen. In den Worten eines deutschsprachigen Pickup-Artists:
„Frauen sind wie Spielautomaten. Wenn du die richtigen Knöpfe drückst, in der richtigen Reihenfolge und ganz genau weißt was du zu tun hast, was du machen muss… dann liebt sie dich… dann geht sie mit dir ne Beziehung ein, dann hast du Sex mit dir. Du kannst alles von ihr haben was du möchtest…“ (Marko Polo [ab Min 5:40]).
In der Szene wird das professionelle, geplante und geübte Bezirzen in Neudeutsch auch als „jemanden gamen“ bezeichnet. Und im übertragenen Sinne zeigt sich die neoliberale Spieltheorie auch im Bild des Flirtmarktes, das die Pickup-Szene immer wieder bemüht.
Die Voraussetzungen erfolgreichen Gamens sind dieselben wie jene der Konsum- und Dienstleistungsgesellschaft. In der Community heißt der Schlüsselbegriff hierzu „Frame“. Seine Bedeutung changiert zwischen „Ausstrahlung“, „Selbstbewusstsein“ und „Überzeugungskraft“. Mal gilt er als äußere Manifestation innerer Werte und Überzeugungen, mal als Inbegriff einer starken Weltanschauung. Einen guten Frame hat, wer selbstbewusst, einen schlechten, wer schüchtern ist.
Die Voraussetzungen erfolgreichen Gamens sind dieselben wie jene der Konsum- und Dienstleistungsgesellschaft.
Diesem Frame gilt die ganze neoliberale Optimierungsarbeit. Und wie für andere Therapiesettings in der Dienstleistungsgesellschaft typisch wird der Frame von außen nach innen umgekrempelt. Modetipps helfen den Schüchternen, „mehr“ aus sich zu machen. Ein langsamer Gang soll Betas lehren, „selbstbewusst“ aufzutreten, eine gute Körperhygiene soll die Angst nehmen, auf fremde Menschen zuzugehen, etc.. Die Regeln wirken für die Pickup-Jünger einsichtig: Je besser der Frame, desto bessere Karten im Spiel.
Egal wie ausgefallen das Äußere eines Pickup-Artists scheinen mag, die konstante Arbeit an seinem Frame könnte konformistischer nicht sein: Jeder einstudierte Anmachspruch, jeder antrainierte Bauchmuskel und jede überwundene Angst zelebrieren den „Kult des starken Ichs“, wie der Soziologe Heinz Bude (2017) den Neoliberalismus prägnant charakterisiert.
Serious games?
Geschlechterpolitisch aktive Gruppierungen kritisieren Pickup einerseits für seine Aggressivität, die den Verdacht sexualisierter Gewalt erweckt, andererseits für seinen Versuch, patriarchale Strukturen zu verteidigen oder wiederherzustellen. Beispielsweise hatten zwei Artikel in der Zeitung des Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta) der Universität Frankfurt vor Pickup-Artists und Belästigungen auf dem Campus gewarnt. Die Veröffentlichungen zogen einen Rechtsstreit nach sich, da sich ein Pickup-Artist aufgrund des öffentlichen Prangers in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt sah (Schubert 2016).
Dieser und andere Fälle werfen eine schwierige Frage auf: Nimmt die Kritik an Pickup diese vermeintliche Kunst nicht zu ernst? Oder anders gefragt: Inwiefern glaubt die Kritik selbst an die Effektivität dieser Techniken? Wohl gemerkt: Bei der Frage geht es nicht um Fälle wie Julien Blanc oder Roosh V; auch nicht um Fälle, die in irgendeiner Form sexualisierte Gewalt gutheißen oder verharmlosen. Zur Debatte steht lediglich Pickup als eine rhetorische Strategie des effektiven Flirtens.

Die Philosophin Judith Butler hat in ihrem vielbeachteten Werk Excitable Speech (2013) die These vertreten, dass auch Äußerungen als Handlungen zu bewerten seien. Entsprechend lässt sich argumentieren, bei den sprachlichen Flirtversuchen der Pickup-Anhänger handele sich um Handlungen und somit um gewalttätige Übergriffe. Indes ist Butlers Einschätzung dieser Sprachhandlungen etwas komplizierter. Einen Großteil des Buches verwendet sie auf die Analyse der Subjekte, die als Sprecher*innen und Empfänger*innen in solche Sprechakte involviert sind. Sie kommt zum Schluss, dass hate speech – beleidigende oder verunglimpfende Äußerungen – erst dann effektiv ist, wenn er öffentlich oder juristisch untersagt wird.
Sobald der Staat Hassrede verbietet, steht unabänderlich fest, an wen sich die Sprechakte richten und wie verletzend sie sind. Erst in diesem Moment erreicht Hassrede wirklich ihr Ziel: Es gibt, gleichsam staatlich anerkannt, Verletzungen und Verletzte. Aus diesem Grund plädiert Butler dafür, verunglimpfenden Sprechakten mit der ganzen Mündigkeit und Freiheit eines unverletzten Subjekts zu begegnen: sie lassen sich zurückweisen, unterlaufen, ironisieren, bagatellisieren, bloßstellen usw.
Sobald der Staat Hassrede verbietet, steht unabänderlich fest, an wen sich die Sprechakte richten und wie verletzend sie sind.
Judith Butler greift in Excitable Speech auf die Sprechakttheorie von John L. Austin (1955) zurück. Darin unterscheidet er zwischen illokutionären und perlokutionären Sprachhandlungen.
Aussagen wie „Hiermit erkläre ich den Krieg.“ oder „Hiermit verurteile ich Dich zu einer Strafe.“ sind illokutionäre Akte, die etwas machen, indem sie es sagen. Die Aussage und der Effekt der Aussage fallen zeitlich zusammen. Krieg herrscht in dem Augenblick, in dem er erklärt wird. Eine Verurteilung erfolgt, wenn sie ausgesprochen wird.
Bei perlokutionären Akten hingegen fallen Effekt und Aussage auseinander. „Bitte schließe das Fenster.“ ist eine Sprachhandlung, die erst dann erfüllt ist, wenn der Effekt nach einer gewissen Zeit (hoffentlich) auch eintritt.
Die entscheidende Frage ist, wie etwa die Aussage „Du bist hässlich.“ zu interpretieren ist. Versteht man sie als einen illokutionären Akt, wird die angesprochene Person tatsächlich zu einer hässlichen Person degradiert. Versteht man sie hingegen als perlokutionären Akt, steht es der so angesprochenen Person frei, sich zu diesem Akt zu verhalten.
Die Beobachtung, dass verunglimpfende Bezeichnungen wie „nigger“, „bitch“ oder „gay“ von den so angesprochenen Menschen etwa im Rap ironisch resignifiziert worden sind, motivieren Butler dazu, eine Aussage wie „Du bist hässlich.“ als einen perlokutionären Akt mit offenem Ergebnis zu interpretieren.
Die Offenheit geht hingegen verloren, wenn eine Autorität wie der Staat die Bedeutung einer solchen Aussage festlegt.
Eine ähnliche Konstellation liegt beim Fall Asta versus Pickup vor. Denn der Mythos der dunklen Verführungskünstler mit geheimnisvoller Macht über andere Menschen wird mit der publizierten Warnung ein Stück weit ungeprüft bekräftigt. Zum einen bestätigt sie die Wirksamkeit der Flirttechniken, zum anderen unterstellt sie hilflos ausgelieferte Opfer. Ohne tatsächliche Belästigungen auf dem Frankfurter Campus relativieren zu wollen, ist kritisch zu prüfen, ob die enorme Aufmerksamkeit und die geschürte Angst den Nimbus der Pickup-Artisten nicht zusätzlich verstärkt.
Mit Pickup spielen
Pickup versucht, mit teils pseudowissenschaftlichen oder esoterischen Mitteln das Selbstbewusstsein von Männern aufzumöbeln. Darin unterscheidet sich das Phänomen aber nicht von anderen neoliberalen Therapie- und Selbstermächtigungskursen, die einem „Kult des starken Ichs“ (Bude 2017) huldigen. Und da Pickup so offensichtlich mit den Idealen einer Konsum- und Dienstleistungsgesellschaft Hand in Hand geht, ist es alles andere, nur das nicht: subversiv.
Literatur
Bude, Heinz. 2017. Das Gefühl in der Welt. Bonn.
Butler, Judith. 1997. Excitable Speech: A politics of the Performative. Berlin.
Illouz, Eva. 2007. Der Konsum der Romantik, Frankfurt am Main.
Kimmel, Michael. 2016. Angry White Men: Die USA und ihre zornigen Männer. Bonn.
Morozov, Evgeny. 2013. Smarte neue Welt. Digitale Technik und die Freiheit des Menschen. München.
Schutzbach, Franziska. 2017. „ ‚Ich kann euch alle haben.‘ Maskulinitätsideologien und Rechtsnationalismus“. In: geschichtedergegenwart.ch, 8.Oktober 2017. Online: http://geschichtedergegenwart.ch/ich-kann-euch-alle-haben/
Schubert, Franziska. 2016. „ ‚Pick-Up-Artist‘ verklagt Asta“. Frankfurter Rundschau, 15.01.2016. Online: http://www.fr.de/frankfurt/campus/goethe-universitaet-pick-up-artist-verklagt-asta-a-388079
Bildnachweis
Das Titelbild zeigt Dagger, wie sie einen schwer bewaffneten Wachmann überwältigt. Scan aus dem Comicbuch Spider-Man – Von Shanghai bis Paris. 2017. Geschrieben von Dan Slott, gezeichnet von Matteo Buffagni und Giuseppe Camuncoli. © Marvel.

uncode-placeholder
Jöran Klatt
Jöran Klatt ist Redakteur bei INDES. Zeitschrift für Politik und Gesellschaft und Mitarbeiter am Göttinger Institut für Demokratieforschung. Er promoviert an der Universität Hildesheim. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören politische Kulturforschung sowie Sprach- und Kommunikationswissenschaften.







für mich ist der zusammenhang im artikel nicht sehr schlüssig aufgezeigt. evtl. hätten sich bezüge verfeinern und etwas differenziertere erkenntnisse präsentieren lassen, indem theorien der arbeitsforschung oder arbeitspsychologie (z.b. interessierte selbstgefährdung von krause oder die gratifikationskrisen von siegrist) eingeflossen wären, anstatt das apodiktische buzzword der selbstoptimierung als alleingültigen begründungszusammenhang zu zementieren. subjektivierungsfiguren allein mit neoliberalität (denn hier geht es um die person, nicht um den markt) zu erklären, ist in meinen augen stark verkürzt.
Dem ist hinzuzusetzen, dass die Beratungsindustrie für die weibliche Kundschaft ein Äquivalent zu „The Game“ bereithält: „The Rules“. Hinter diesem Bestseller steht ein riesiges Netzwerk von Büchern, Kursen, Foren, Selbsthilfegruppen etc. etc. für Frauen auf Partnersuche. Einige Prinzipien sind überraschend ähnlich (am Selbstbewusstsein arbeiten; alles aus dem Aussehen herausholen), andere unterscheiden sich deutlich (stets passiv bleiben und retardieren; ihm das Leben leicht, es ihm in allen Lebenslagen recht machen). Auch hier wird als Kaufanreiz ein Vorsprung vor der Konkurrenz durch Geheimwissen versprochen; auch hier wird die mühsame Verstellung durch vorangegangene Kränkungen moralisch gerechtfertigt.
Fatal nun (und die Gründe für tatsächliche, derzeitige, mehrheitliche, angebliche, … Vorlieben von Frauen und Männern einmal agnostisch beiseitegelassen): Beiden Zielgruppen werden mit One Night Stand vs Ehe diametral entgegengesetzte Lebensziele und Herzenswünsche nahegelegt, und Wille und Charakter der nicht passfähigen Kundschaft werden gebrochen und neu geformt auf die Extreme Aktivität vs Passivität hin. Von Millenials bis Babyboomern auf dem Markt – nahezu alle haben im Ergebnis Angst und taktieren mit Erwartungserwartungen; alle schauen nach noch besseren Optionen, aber mögen sie wen, so zeigen sie das auf gar keinen Fall!
„Mit der ganzen Mündigkeit und Freiheit eines unverletzten Subjekts“, wie es im Artikel treffend heisst, liesse sich nun überlegen, ob wir so leben wollen. Oder, neoliberal gesprochen, ob sich dieser Einsatz eigentlich auszahlt.