Eigentlich wollten wir mit Andreas Kraß ein Interview zu Männerfreundschaften führen. Entwickelt aber hat sich ein Gespräch, das von „schwul“ über #MeToo bis Harry Potter all das anspricht, was sogenannte „Männer“ verunsichert. Männerfreundschaften inklusive.

Andreas Kraß hat 2016 ein Buch über die Männerfreundschaft veröffentlicht. Er ist Professor für ältere deutsche Literatur und leitet seit 2012 die Forschungsstelle Kulturgeschichte der Sexualität an der Humboldt-Universität zu Berlin. Wir haben den Literaturwissenschaftler und engagierten Männerforscher in einem Straßencafé in Berlin getroffen.
AV: Bevor wir Sie zur Männerfreundschaft befragen – dürfen wir Sie um eine Einschätzung der aktuellen Verunsicherung von Männern bitten? Vor kurzem ist in der ZEIT eine Replik auf #MeToo erschienen. Der Autor Jens Jessen beklagt die Infragestellung des Geschlechtswesens „Mann“ und fühlt sich angegriffen. Dabei übersieht er die Chance, Männlichkeit neu zu definieren; auch „Männer“ wollen ja nicht notwendigerweise in den alten patriarchalen Strukturen leben.
AK: Die Verunsicherung der Männer hat eine längere Vorgeschichte. Schon im frühen 20. Jahrhundert gab es feministische Bewegungen, Frauenrechtlerinnen forderten u.a. das Wahlrecht. Zeitgleich formierten sich die ersten homosexuellen Befreiungsbewegungen, hier in Berlin war der Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld eine zentrale Gestalt. Bereits damals wurde in Frage gestellt, was wir heute hegemoniale Männlichkeit nennen. Diese definiert sich einerseits durch die Privilegierung des Mannes gegenüber den Frauen, andererseits durch den Vorrang der Heterosexualität gegenüber anderen Sexualitäten. Der Nationalsozialismus und die Nachkriegszeit unterbrachen diese Aufbrüche und sorgten für restaurative Tendenzen.
Bei Männern wird das Engagement für Gleichberechtigung ja oft gerade dann stärker, wenn sie sich für ihre Töchter verantwortlich fühlen.
Wir befinden uns heute in einer Zeit, in der die Geschlechterverhältnisse neu definiert werden. Daran beteiligen sich besonders Menschen, die in weniger repressiven Verhältnissen aufgewachsen und von Eltern erzogen worden sind, die ein Interesse am beruflichen Erfolg ihrer Töchter haben. Bei Männern wird das Engagement für Gleichberechtigung ja oft gerade dann stärker, wenn sie sich für ihre Töchter verantwortlich fühlen. Die derzeitige Befreiungsbewegung lässt sich als historisches Ereignis sehen und anhand von charakteristischen Lebensläufen rekonstruieren. Man kann die biographische Erfahrung, eine Tochter zu haben und sich für sie einzusetzen, nur in bestimmten Jahrzehnten machen.
AV: Bietet die Männlichkeitsforschung eine Antwort auf die aktuelle Verunsicherung?
AK: Die Männlichkeitsforschung kennt affirmative und kritische Spielarten. Einerseits versucht sie aus einem konservativen Interesse heraus die alte und privilegierte Ordnung wiederherzustellen, auch mithilfe wissenschaftlicher Konzepte und Begriffe. Andererseits gibt es progressive Forschende, die ihre Impulse aus den gender und queer studies beziehen. Sie nehmen Männlichkeit kritisch und stets in Beziehung zu anderen Geschlechtern wahr.
AV: Neben der gegenwärtigen Verunsicherungswelle registrieren wir spätestens seit den ersten PISA-Studien einen Krisendiskurs um den jungen Mann. Dieser wachse, so die Diagnose von Presse und besorgten Eltern, in feminisierten Umgebungen auf. Er könne sich nicht angemessen ausleben, seine Aufmüpfigkeit werde mit Ritalin therapiert etc.
AK: Die aktuelle Debatte um männliche Privilegien lässt uns aufhorchen, wenn es um angeblich benachteiligte junge Männer geht. In dem Augenblick, in dem wir unseren Blick auf die Krise der jungen Männer lenken, blicken wir ja von der Krise junger Frauen weg. In der Frage nach verunsicherten Männern – egal wie kritisch sie sich gibt – wird abermals bekräftigt, dass die jungen Männer doch ein wenig interessanter seien als die jungen Frauen.
Wir sollten eher über die Krise der jungen Frau sprechen.
Wir sollten eher über die Krise der jungen Frau sprechen. Junge Frauen sind oft als Schülerinnern besonders fleißig und leistungsfähig. Ab einem bestimmten Alter schlägt das um. Plötzlich stoßen die Mädchen mit ihren Talenten und Fähigkeiten an gläserne Decken. Umgekehrt erhalten junge Männer unerwartet Anerkennung, die ihre bisherigen Misserfolge wiedergutmacht. Auch wenn ihre schulischen Leistungen geringer waren, verdienen sie oft weit mehr als ihre klugen Klassenkameradinnen.
AV: Das Thema Transgender lässt das Auseinanderbrechen eines bipolaren Koordinatennetzes erkennen. Dies könnte einen Entwicklungshorizont eröffnen, der den jungen Männern klar macht, was alles möglich ist und weniger, in welche fixe Rolle sie sich zu fügen haben. Doch woran orientieren sich junge Männer?
AK: Junge Männer orientieren sich vielfach an Fantasien, die ihnen in Büchern, Filmen und Videospielen angeboten werden, und somit am „kulturellen Imaginären“ einer doch sehr heteronormativen Männlichkeit. Gelegentlich werden auch leicht beschädigte Helden gezeigt wie zum Beispiel in den Avenger- Filmen. Gerade das macht sie mainstreamfähig. Dem Heranwachsenden bestätigen solche Filme, dass das Rollenbild des männlichen Superhelden grundsätzlich erstrebenswert ist.
AV: Gibt es ein Merkmal, das all diese Helden gemeinsam haben? Grob geschätzt sind 80 Prozent Waisenkinder. Harry Potter, Batman, Wolverine oder Oliver Twist. Zudem sorgt häufig genug ein Unfall für die Transformation von Teenie zu Held…
AK: Das ist das Narrativ der „besonderen Geburt“. Joseph Campbell hat das in seinem bekannten Buch Der Heros in tausend Gestalten dargelegt. Er analysiert all die verschiedenen Biographien von Göttern, Halbgöttern und Helden. Ein wichtiges Element in allen heroischen Geschichten ist die ausgezeichnete Geburt – von Herakles über Siegfried bis hin zu den Science-Fiction-Helden.
Seit der Antike gibt es in allen Epochen ein Repertoire an Heroen, an denen sich Kinder orientieren. In ihrem Spiel überschneiden sich Realität und Fantasie, hier üben sie auch ihre Geschlechterrollen ein. Deshalb finde ich es so erstaunlich, dass wir einerseits über Gleichberechtigung, Emanzipation und angemessene Schulförderung diskutieren, dass andererseits aber das heteronormative Fantasie-Universum massiv zurückschlägt. Unabhängig von allem, was wir debattieren, teilt die Konsumindustrie die Welt nach wie vor in Pink und Blau ein. Es gibt ja keinen ersichtlichen Grund, warum Spielzeug gegendert sein soll. Andererseits ist es erfreulich, wenn Jungen mit Barbie-Prinzessinnen und Mädchen mit Feuerwehrautos spielen dürfen, ohne dass ihre Eltern nervös werden.
AV: Überblickt man die Literatur der letzten 500 Jahre, scheint es für die männlichen Heranwachsenden eine Art Moratorium zu geben, in dem sie aufgefordert werden, sich auszutoben. Egal, was sie in dieser Zeit anstellen, es wird ihnen verziehen.
AK: Ein junger Mann zu sein, ist sehr ambivalent. Auf der einen Seite erwartet die Mehrheitsgesellschaft von ihm, herausfordernde Erfahrungen zu machen, seine Körperkraft aufzubauen, abenteuerliche Dinge auszuprobieren. Auf der anderen Seite erzeugt genau diese Erwartungshaltung ein Gefühl des Scheiterns und Ungenügens. Hier schlägt das Universum der Superhelden erneut zurück, denn die heroischen Männlichkeitsideale bleiben in der Realität stets unerreichbar. Wenn Jungen gegenüber Mädchen privilegiert werden, nur weil sie Jungen sind, so wird ihnen eine Bestätigung für etwas gegeben, das unverdient ist. Dafür, dass sie Jungen sind, können sie ja nichts.
Das ist die eigentliche Krux: dass der Mann Privilegien verteidigt, die er nur deswegen hat, weil er ein Mann ist.
Permanent für etwas bestätigt zu werden, das man nicht geleistet hat, erzeugt einen double bind. Man hat das Gefühl, etwas bestätigen zu müssen, für das man eigentlich nicht verantwortlich ist. Es ist die bloße Tatsache des Männlichseins, die dem Jungen oder Mann diese Vorteile verschafft. Das ist die eigentliche Krux: dass der Mann Privilegien verteidigt, die er nur deswegen hat, weil er ein Mann ist – Privilegien, die er nicht durch Leistung, Fleiß, Talent oder eine besondere Gabe erworben hat.
AV: Sind die jungen Männer wirklich in der Lage, ihre unverdienten Privilegien zu durchschauen? Schließlich assistieren eine Reihe von Naturalisierungen und Biologisierungen dem Mann in seiner Überzeugung, er sei „erfinderischer“, könne „nüchterner denken“, oder einfach grundsätzlich etwa bewegen. All diese Aussagen wirken wie Fallschirme, welche davor bewahren, zu erkennen, wie unverdient Männer-Privilegien sind.
AK: Naturalisierung heißt, dass eine sozial und kulturell hergestellte Hierarchie und Asymmetrie als Natur verschleiert wird. Das ist die Lektion, die Roland Barthes in seinen Mythen des Alltags erteilt. Wir verdecken die Einsicht in die Gewordenheit von Machtverhältnissen, wenn wir sie zur Natur erklären.
Nehmen Sie folgendes Beispiel. Jemand sagt: „Es gibt viele Männer, die ihre Frauen schlagen“. Ein anderer erwidert: „Ja, aber es gibt auch Frauen, die ihre Männer schlagen.“ Nun besteht der ideologische Trick darin, eine scheinbare Balance herzustellen, um das Problem so aufzulösen: „Es gibt das eine, es gibt das andere, also gleicht sich das aus.“ Wenn man aber auf die tatsächlichen Zahlen schaut, wird natürlich schnell deutlich, dass die Zahl der schlagenden Männer die der gewalttätigen Frauen proportional weit übertrifft.
AV: Nun gehören zum jungen Mann nicht nur die Krise und das Ungenügen und die unverdienten Möglichkeiten. Junge Menschen, junge Männer sind ja auch großartig. Die Welt steht ihnen offen, ihre eigenen Möglichkeiten euphorisieren sie.
AK: Mädchen und Jungen empfinden beim Heranwachsen gleichermaßen das Gefühl, plötzlich über ungeahnte Kräfte zu verfügen und etwas erreichen und bewegen zu können. Die Frage ist nur, wer hier euphorisch in die Luft springen darf und bei welchen Gelegenheiten? Wer wird ermutigt und wer wird entmutigt? Die gesellschaftlichen Strategien der Ermutigung und Entmutigung sind entscheidend. Mit diesen Strategien werden junge Menschen in ihre Geschlechterrollen eingewiesen.
Mit den gesellschaftlichen Strategien der Ermutigung und Entmutigung werden junge Menschen in ihre Geschlechterrollen eingewiesen.
AV: Sich mit jungen Männern zu beschäftigen, heißt, sich mit Militär, Sportclubs oder Internaten zu befassen. Bis vor wenigen Jahren waren die Männer in diesen Institutionen ausschließlich unter sich. Das wirft die Frage nach dem Verhältnis von Homosozialität und Homosexualität auf. Gelegentlich haben wir den Eindruck, Männer können nur dann Blutsbrüderschaft, Teamplay etc. ausagieren, wenn sie jeden Verdacht auf Homosexualität ausmerzen.
AK: Zunächst einmal ist festzuhalten, dass Homosexualität ein wissenschaftliches Konzept des 19. Jahrhunderts ist, mit dem man bis heute versucht, Ordnung zu schaffen und Normalität herzustellen. Homosexualität dient als negative Folie, um ein sehr heterogenes Feld in zwei Bereiche zu zerteilen: einen „normalen“ auf der einen, einen abweichenden auf der anderen Seite. Die Normalität definiert sich in Abgrenzung von dem, was als „anders“ imaginiert wird.
Männer müssen sich dauernd fragen, wo die Freundschaft aufhört und die Homosexualität beginnt.
Homosozialität ist ein weites Feld. Um Nahbeziehungen zwischen Männern zu beschreiben, verwende ich gerne den Begriff des homosozialen Begehrens von Eve Kosofsky Sedgwick. Affektive Beziehungen zwischen Personen desselben Geschlechts sind zum Beispiel die Liebe zwischen Vater und Sohn, die Sympathie zwischen Lehrer und Schüler, ein gutes Verhältnis zwischen Chef und Angestelltem, eine enge Freundschaftsbeziehung, eine sportliche Beziehung in einer Fußballmannschaft.
Dieses filigrane und verästelte Kontinuum wird nun durch das Tabu der Homosexualität in der Mitte durchbrochen. Männer müssen sich dauernd fragen, wo die Freundschaft aufhört und die Homosexualität beginnt. Der Diskurs der Homosexualität wirkt wie ein Skalpell, das das Gewebe des homosozialen Begehrens durchschneidet in einen Bereich, der affirmiert und einen Bereich, der diskriminiert wird. Deshalb thematisieren männliche Gemeinschaften geradezu zwanghaft Homosexualität, um sich in der Ablehnung zu vergewissern, dass sie selbst auf gar keinen Fall homosexuell sind.
Homosexuelle Männer müssen gar nicht anwesend sein, damit diese Form der Selbstvergewisserung funktioniert. Es reicht, dass man seine Vorurteile und Zerrbilder pflegt und sich gelegentlich einmal einen Mann vorknöpft, den man als „schwul“ hinstellt und dann verprügelt. An ihm wird stellvertretend die homophobe Angst ausagiert, selbst nicht normal zu sein. Dasselbe gilt für die Phobie gegen Trans-Menschen.
AV: Hat die Angst, als „schwul“ zu gelten, in den letzten Jahren noch zugenommen? Derzeit sehen wir wenige Abbildungen von Männern, die sich zärtlich berühren.
AK: Die Frage lässt sich wohl so grundsätzlich nicht beantworten. Es gibt ja viele ritualisierte Berührungen. Das beginnt beim Schulterklopfen und endet bei komplizierten Formen des Abschlagens mit den Händen. In diesen Ritualen wird immer wieder eine Ambivalenz sichtbar. Einerseits gibt es den Wunsch nach körperlicher Nähe, die für Kinder als normal gilt. Beim Eintritt in die Pubertät wird der Junge dann dazu angehalten, sich diese körperliche Nähe abzugewöhnen. Irgendwann bekommt er keinen Gutenachtkuss mehr von seinem Vater, und der Papa schmust auch nicht mehr mit ihm. Andererseits erlischt der Wunsch nach körperlicher Nähe auch zu Personen des eigenen Geschlechts nicht einfach. Ich glaube, dass hier eine Ritualisierung des Körperkontaktes einspringt. Solche Riten ermöglichen einerseits körperlicher Nähe, andererseits verleihen sie ihr eine höhere soziale Bedeutung.
AV: Wie ritualisiert und kodiert denn die Literatur die Freundschaftsbeziehungen unter Männern? Wie kanalisiert, inhibiert oder aktiviert sie das homosoziale Begehren?
AK: In der westlichen Literatur und Philosophie sind Männerfreundschaften in Form von Mentoratsbeziehungen zwischen Lehrern und Schülern sehr häufig. Zwischen ihnen werden eine Zuneigung und eine Intimität beschrieben, die nicht nur eine erotische, sondern auch eine pädagogische Dimension haben. Die Freundschaft zwischen einem älteren und einem jüngeren Mann ist eine Konstante, die in verschiedenen Epochen und Kulturen nur verschieden eingefärbt ist.
Pädophile Übergriffe wurden oft als pädagogischer Eros gerechtfertigt und vertuscht.
In der griechischen Antike gibt es bekanntlich das philosophische Ideal, das zwischen Lehrer und Schüler eine gegenseitige Attraktion bestehen soll, die einen Tausch impliziert. Der Lehrer erfreut sich an der Schönheit und Jugend des Knaben, dieser wiederum an der Weisheit und dem Ansehen seines Mentors. Man kann das mit der mittelalterlichen Beziehung zwischen Ritter und Minnedame vergleichen: Der schöne Jüngling ist für den Lehrer ein Objekt des Begehrens, das sich unerreichbar machen muss, aber deswegen umso heftiger umworben wird. Das christliche Mittelalter hat das Modell des pädagogischen Eros vor allem in monastischen Milieus weitergeführt, wenngleich deutlich argwöhnischer. Aufgrund der Verurteilung von gleichgeschlechtlicher Sexualität ist ein Schatten auf diese Form der Freundschaft gefallen; andererseits wurden pädophile Übergriffe oft als pädagogischer Eros gerechtfertigt und vertuscht.
AV: Wird der Eros in diesen Mentoratsbeziehungen aufgrund der Unerreichbarkeit des Jünglings nicht ebenfalls verhindert? Das erinnert doch sehr an das Homosexualitätstabu des 19. Jahrhunderts…
AK: Darin besteht ja gerade die Paradoxie, dass die Unerreichbarkeit des begehrten Objekts das Begehren selbst steigert. Im Übrigen gehorchen Männerfreundschaften in der Literatur stets bestimmten Codes und Regeln. Eine typische Konstellation ist die Triangulierung. Man führt eine dritte Figur ein, meist eine weibliche, beispielsweise eine Mutter. Die Freunde kennen sich seit ihrer Kindheit und sind von der gleichen Mutter geliebt und aufgezogen worden. Nur handelt es sich bei dem einen Sohn nicht um einen leiblichen Bruder, sondern um einen Pflege- oder Adoptivsohn.
AV: Den Milchbruder…
AK: Genau, so wie bei Hamlet und Horatio, Achill und Patroklos oder Gilgamesch und Enkidu. Durch die gemeinsame Kindheit und die gemeinsame mütterliche Bezugsfigur werden Freundschaft und Brüderlichkeit eng aneinander gekoppelt. Die Verschwägerung ist ein weiterer Topos. Niklas Luhmann hat das in seinem Buch Liebe als Passion schön auf den Punkt gebracht: „Zuerst innige Freundschaft, geheiratet wird dann die Schwester des Freundes.“
Die Freundschaft wird über die Verschwägerung in eine familienartige Beziehung überführt. Beispiele sind in der Moderne Tennyson und sein Freund Hallam, im Mittelalter Roland und sein Waffenbruder Olivier, in der Antike Cicero und Atticus (dessen Schwester Ciceros Bruder heiratete).
Eine dritte Technik besteht darin, eine negative Nebenfigur einzuführen, um so die Hauptfigur zu entlasten. Ein Beispiel ist die mittelalterliche Fassung von Vergils „Aeneis“. Amata, die Mutter der Lavinia, versucht ihrer Tochter Aeneas auszureden, indem sie darauf hinweist, dass er früher schon seine Ehefrau Dido verlassen habe, und behauptet: „Er hat es nicht so mit den Frauen, mit ihm wirst du niemals glücklich werden. Was Männer mit Frauen machen, das macht er mit anderen Männern.“ Im Nachhinein stellt sich heraus, dass der Vorwurf unberechtigt ist, und mit der Figur, die den Zweifel ausgesprochen hat, wird auch der Zweifel selbst abserviert – Amata stirbt kurz darauf. So fällt dann auch kein Schatten mehr auf die passionierte Beziehung, die Aeneas mit seinem jungen Freund und Waffenbruder Pallas führte.
AV: In ihrem Buch gibt es noch eine weitere Technik zur Beförderung und Camouflage der Liebe, eine weitaus tödlichere…
AK: Ja, das Hauptinstrument – das war überhaupt der Anlass meines Buches. Fast immer muss einer der Freunde sterben. Die Dichter wählen die Situation der Totenklage als Lizenz, um in passionierter Weise über die Freundschaft sprechen zu können. Das sind also Passionsgeschichten im doppelten Sinn. Der eine Freund ist gestorben, der andere beklagt den Verlust. Das Setting des Leidens erlaubt die Leidenschaft. Wohl achtzig Prozent der literarischen Texte, die von passionierten Freundschaften erzählen, enden mit dem Tod eines der Freunde. Trauer, Klage und Mitleiden sind sozusagen die Fortsetzung des homosozialen Begehrens im Zeichen des Todes. Ich war daher zuerst sehr geneigt, mein Buch „Nur über seine Leiche“ zu nennen.
AV: Das deutet darauf hin, dass nur der Tod die letztlich legitime Form einer Männerfreundschaft ist.
AK: Später, bei Tristan und Isolde oder Romeo und Julia, kommt dann noch die Hetero-Variante hinzu. Aber ja – wenn man den Dichtern glaubt, dann ist der Tod der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Der Tod ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Literatur
Kraß, Andreas. 2016. Ein Herz und eine Seele: Geschichte der Männerfreundschaft. Frankfurt am Main.
Bildnachweis
Das Titelbild zeigt Batman im Kampf gegen Victor Fries alias Mr. Freeze. Scan aus dem Comicbuch Batman: The City of Owls. 2013. Geschrieben von Scott Snyder und James Tynion, gezeichnet von Greg Capullo, Jonathan Glapion et al. © DC.
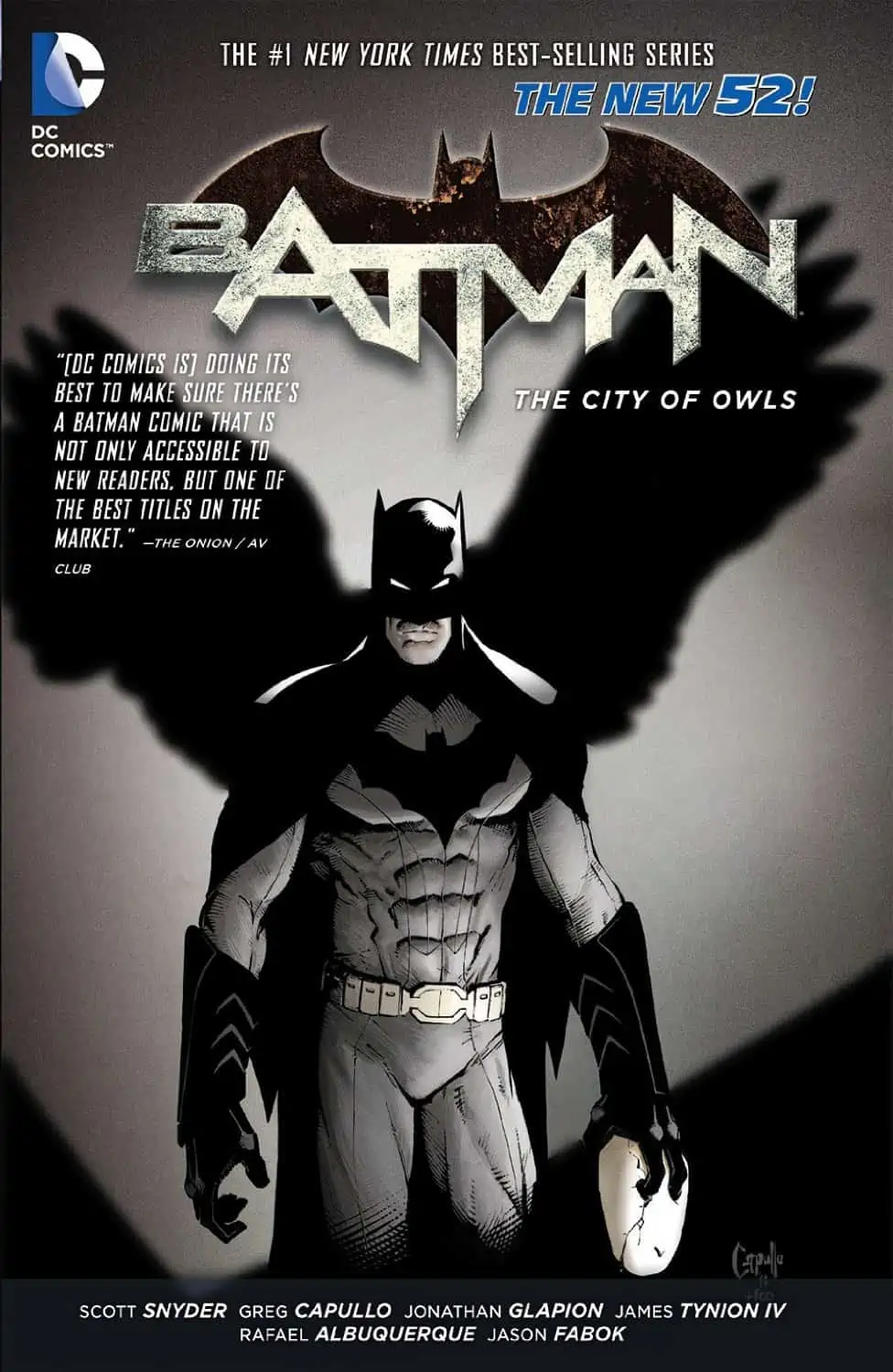
uncode-placeholder
Herausgeber*innen
Anmerkung: Die Herausgeber*innen der Avenue lancierten zu Weihnachten 2020 die Initiative Salz + Kunst als Antwort auf die Einschränkung des künstlerischen Lebens während der Corona-Pandemie. Im Sinne von art on demand vermittelt die Plattform Kunststücke nahezu aller Kunstsparten in den privaten Raum: ein Jodel im Vorgarten, ein philosophisches Gespräch per Zoom, ein Gedicht per Whatsapp, ein Violinkonzert auf dem Balkon …







Ich weiß nicht, wie der Autor zu der Feststellung kommt, dass Männer sich dauernd fragen müssten, wo die Freundschaft aufhört und die Homosexualität beginnt. Das ist doch absurd! Hier wird wieder so getan, als sei Homosexualität das Normalste von der Welt. Ist sie aber nicht. Wenn es nur Homosexuelle gäbe, würde die Menschheit aussterben. Hier wird den „Normalen“ ständig unterstellt, ihr Verhalten sei „unnormal“ und sie müssten sich umorientieren. Täten sie das nicht, sind sie vermutlich Rassisten, Rechtsradikale oder sonstige Toleranzverächter. Das ist für mich eine fehlgeleitete Weltsicht, mit der ich nichts zu tun haben will. Ich sehe es auch nicht ein, dass ich mich mit diesem Thema überhaupt beschäftigen muss. Ich bin nicht homosexuell und habe auch nicht die Absicht, es zu werden.
Lieber Herr Möller,
wir zwingen Sie nicht, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Zudem möchten wir Sie bitten, sich auf dieser Seite an eine gewisse Netiquette zu halten – ob Sie nun unter diesem oder einem anderen Pseudonym schreiben. Danke, die Redaktion/MK & CV
Herr Kraß spricht „gläserne Decken“ an, an die junge Frauen irgendwann stoßen. Ich stimme dem zu, frage mich aber, worin genau diese bestehen. Denn tatsächlich scheinen sich junge Frauen in der Schule leichter damit zu tun, die erwarteten Leistungen zu erbringen und Anerkennung zu erhalten. Funktioniert denn nun das System der Universität und des Arbeitsmarktes so gänzlich anders? Vielleicht werden hier plötzlich profiliertes, konfrontatives Auftreten und das Selbstvertrauen, dass man für Karriere und Erfolg bestimmt ist, zu den entscheidenden Faktoren? Mir scheint, dass das ein wichtiger Teil der angesprochenen männlichen Privilegien ist – und gleichzeitig potentiell problematisch für junge Männer, die dem nicht entsprechen können oder wollen: Dass dieses Auftreten und Selbstvertrauen konstitutive Elemente gelungener Männlichkeit sind. Wenn das so ist, müssen wir uns aber ernsthaft fragen, welche Mechanismen jungen Frauen einreden, sie müssten zurückhaltend und harmonisierend sein und ihre Bestimmung für Erfolg und Karriere immer wieder neu unter Beweis stellen.
Interessantes und aufschlussreiches Interview aber:
«In dem Augenblick, in dem wir unseren Blick auf die Krise der jungen Männer lenken, blicken wir ja von der Krise junger Frauen weg. In der Frage nach verunsicherten Männern – egal wie kritisch sie sich gibt – wird abermals bekräftigt, dass die jungen Männer doch ein wenig interessanter seien als die jungen Frauen.»
Hier liegt entweder ein logischer Fehlschluss vor oder ein ideolgisch motivierter Fokus auf die Problematiken junger Frauen: es wird einerseits gefordert, man solle den Blick nicht von der Krise der jungen Frauen abwenden, andererseits wird impliziert, dass man nicht beide Problemfelder – Krise der jungen Frauen, Krise der jungen Männer – gleichzeitig im Blick behalten könne. Konsequenterweise würde das heissen, dass man sich ausschliesslich mit der Krise junger Frauen befassen darf. Eine weitere mögliche Interpretation wäre, dass man gänzlich auf ein gegenderte Sichtweise der Problematiken junger Menschen verzichtet. Dies allerdings widerspricht den empirischen Daten wie z.B. Schulnoten, denen auch AK nicht widerspricht.