Benjamin (7) und Niklas (9) horten beide Steine. Doch während Benjamin allein und ausgiebig seine Schätze poliert, lässt Niklas Freunde und Verwandte mit verbundenen Augen raten, welche Sorte sie in der Hand halten. Malin (8) und Franziska (8) sammeln zwar kommerzielle Spielzeuge, darunter Filly-Pferde. Doch im Spiel mit ihren Sammelstücken offenbaren sie eine so verblüffende Originalität, dass Ludwig Duncker resümiert: „Wir erfahren hier ganz direkt etwas über das Kind, seine Aufmerksamkeiten, seine Wahrnehmungen und Wünsche“. Der renommierte Erziehungswissenschaftler hat für sein Buch Wenn Kinder sammeln (2014) Dutzende kindlicher Depots analysiert, die vor allem eines zeigen: Kein Kind sammelt wie das andere.
Die Reformpädagogin Maria Montessori (1938) erklärte die „Sammelwut” und den „Besitztrieb” der Kinder noch zum Symptom inneren Übels. Die Kleinen würden sich „wie die Fangarme einer Qualle” an Gegenstände heften, um den Liebesmangel einer abweisenden Umwelt zu kompensieren. Heute begreifen Psychologie und Pädagogik Sammeln dagegen vermehrt als Weg, auf dem das Kind zum autonomen Subjekt heranreift. Sammeln gilt als „kulturelle Praxis“ (Wilde 2015), durch die das Kind konzentriert die Welt kennenlernen und begreifen kann. Die kleinen Sammler*innen setzen sich intensiv mit ihren Fundstücken auseinander, ordnen sie in Kategorien und Kästchen, fügen ihnen Namen und Beschreibungen hinzu.
Kinder wollen keine Sammlungen, sie wollen sammeln.
Doch ist Sammeln ein Bildungsweg? Aus Kindersicht wahrscheinlich nicht. Angesichts der Spiele, die die Kleinen mit ihren Objekten treiben, gehorchen die Sammlungen keinem festen Zweck. Ganz im Gegenteil herrschen hier oft Unordnung und Vernichtungswille. Die Kinder verstecken oder lösen ihre Kollektionen ähnlich rasch auf, wie sie sie zusammengetragen haben. Die Bestände landen unterm Bett oder neben dem Klo. Sie finden sich zusammengeworfen in Eimern oder in Dosen wieder. Gelegentlich werden sie besichtigt, nur um gleich wieder verpackt zu werden. Anders als Museen, Depots und Archive sind Kindersammlungen also weder von langer Haltbarkeit noch von grosser Repräsentativität.
Kinder wollen keine Sammlungen, sie wollen sammeln. Im Dialog mit Ludwig Duncker und auf den Spuren von Julia Kristeva, Sigmund Freud und Walter Benjamin sucht dieser Artikel nach Indizien, mit denen sich kindliche Sammellust spielerisch begreifen lässt. Hier wird das Gesetz des Zufalls wichtiger als die forcierte Suche nach bestimmten Objekten. Sammeln wird zur körperlichen Erfahrung, besonders wenn es um Ekliges geht. Und der Umgang mit den Objekten besteht vor allem im Zeigen und Verstecken, Suchen und Finden.
All diese Eigenschaften infantilen Sammelns kontrastieren scharf mit den absichtsvollen, dauerhaften und repräsentativen Sammlungen Erwachsener. Sie lassen außerdem Zweifel aufkommen, ob Pädagogik und Didaktik kindliches Sammeln gezielt fördern können. Dieses bleibt letztlich zu rätselhaft, um von einem pädagogischen Zugriff entzaubert zu werden.
Briefmarken und Barbies: Das Gesetz des Zufalls
In unserem Gespräch bedauert Duncker die Einseitigkeit, mit der die Pädagogik dem kindlichen Sammeln begegne. Sie fokussiere zu sehr auf eine zielorientierte Didaktik, um die Chance einer dinggeleiteten Erziehung zu erkennen: „Die Schule geht vorschnell in die Abstraktion und begriffliches Arbeiten. Wir brauchen mehr Raum für das Plötzliche, das Hin- und Hersuchen, fürs Zeitvergessen und Vertiefen.“ Eine solche „ästhetische Bildung“, wie Duncker sie in seinem neuesten Buch (2018) beschreibt, erfahren Kinder in erster Linie bei Sammelspielen. Dabei untersuchten sie ihre Objekte ganz genau, erschlössen neue Themengebiete und kultivierten ihre Neugier. Außerdem erkundeten die Kleinen im Spiel die Zeit. Die gesammelten Dinge enthalten Erinnerungen an liebe Menschen und wertvolle Momente – seien dies das Feuerwehrauto, das der Vater geschenkt hat, Omas Servietten, die nun das gesamte Kinderzimmer dekorieren, oder Schlümpfe, die auch schon die Mutter gesammelt hat.
„Sammeln und Kaufen ist für mich eigentlich was komplett Anderes“ Tom (11)
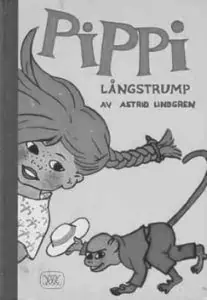
Doch die welterschließende Funktion kindlichen Sammelns gehorcht meist dem Gesetz des Zufalls. Selbst Kinder, die wie Lara (10) ihre Briefmarkensammlung als Altersvorsorge verstehen, bemessen den Wert der Dinge nicht am ökonomischen Gehalt, den die Erwachsenen ihnen zuweisen. Viele wollen gar nicht sammeln, was echtes Geld kostet. Weit höher im Kurs stehen Geschenktes oder Gefundenes. „Sammeln und Kaufen ist für mich eigentlich was komplett Anderes“, meint Tom (11), stolzer Kronkorkensammler. Kinder warten lieber auf den Zufall und erst, wenn sie „lange keinen Zufall mehr hatten“, suchen und beschaffen sie sich gezielt ihre begehrten Objekte (Duncker et al. 2014).
Mit Pippi Langstrumpf (1945) hat Astrid Lindgren dem Zufall kindlichen Sammelns ein Denkmal gesetzt. Als „Sachensucherin” findet Pippi mit verschlossenen Augen all jene Dinge, die notwendig zu finden sind, darunter Straußenfedern, Goldklumpen, Schraubenmuttern, Knallbonbons und nicht zuletzt: tote Ratten.
„‚Ich werde jedenfalls nicht auf der faulen Haut liegen. Ich bin nämlich ein Sachensucher, und da hat man niemals eine freie Stunde.”‘ […] ‚Was ist das?‘, fragte Thomas. ‚Jemand, der Sachen findet, wisst ihr. Was soll es anderes sein‘, sagte Pippi. ‚Die ganze Welt ist voll Sachen, und es ist wirklich notwendig, dass jemand sie findet. Und das gerade, das tun die Sachenfinder.‘ ‚Was sind denn das für Sachen?‘, fragte Annika. ‚Ach, alles mögliche‘, sagte Pippi. ‚Goldklumpen und Straußfedern und tote Ratten und Knallbonbons und kleine Schraubenmuttern und all so das.‘ “
Schnecken und Schädel: Die Liebe zum Abseitigen
Das Gesetz des Zufalls geht mit einer Liebe zum Abseitigen einher, das die andere, gewissermaßen ‚asoziale‘ Seite kindlicher Sammlungen ausmacht. So verheimlicht Tom, der neben Kronkorken auch abgelaufene Busfahrkarten zusammenträgt, seinen Eltern regelmäßig, wenn etwas von der Strasse in seine Sammlung wandert. „Wer sammelt, muss Opfer bringen”, so Tom. Auch Mattheo (8) und Jannis (11), beides leidenschaftliche Sammler toter Tiere, sehen sich zu Kompromissen gezwungen. Jannis etwa darf die Schädel und Gebisse nur im Garten eines Freundes aufbewahren, während Mattheo alles gründlich reinigen und auch einiges wegwerfen muss.
Das Ritual des Reinigens und damit Ertastens und Befühlens der Gegenstände ist bei vielen Kindern Hauptbeschäftigung mit ihrer Sammlung. Benjamin (7) putzt seine Edelsteine oft stundenlang, verspürt aber auch große Lust sich diese Tätigkeit zu verweigern: „Gestern zum Beispiel habe ich die Steine einfach nur mal angeschaut und nicht angefasst.“ Dabei kam ihm der Gedanke, einer davon könnte „versteinerte Kacke” sein. Fasziniert und gebannt reinigen Mattheo und Jannis immer wieder die Höhlen und Windungen ihrer toten Objekte. Auch Liliane (7), die eine lebendige Schneckensammlung im Garten pflegt, findet „cool”, wenn die Tiere überall „rumglitschen”. Dabei bedenkt sie auch deren Verdauung: „Die haben so eine Art Zunge, die das zerdrückt. Und dann quetschen sie das nach hinten, in den Popo” (Duncker et al. 2014).
Mit Vorliebe tragen Kinder zusammen, was vom normalen Leben ausgeschlossen ist: Das Ausgeschiedene, das Schmutzige und das Tote.
Das Beobachten und Berühren glitschiger, toter oder fäkaler Oberflächen, das Denken und Phantasieren an den Grenzen zu Tod und Ekel mischt sich hier in das pädagogisch wertvolle Spiel von Selbst- und Welterkundung. Infantiles Sammeln ist nicht nur ästhetische Bildung, sondern eine körperliche, ja viszerale Erfahrung. Mit Vorliebe tragen Kinder zusammen, was vom normalen Leben ausgeschlossen ist: Das Ausgeschiedene, das Schmutzige und das Tote. All dies sind Dinge, die Julia Kristeva (1980) zu Abjekten erklärte. Sie rufen Ekel beziehungsweise Abjektion hervor, weil sie die Grenzen des Ichs, vor allem aber die Grenzen von Leben und Tod überschreiten.
„Nicht etwa fehlende Reinheit oder Gesundheit verursachen Abjektion, vielmehr das, was jede Identität, jedes System und jede Ordnung stört; das also, was Grenzen, Positionen und Regeln missachtet. Das Dazwischen, das Zweideutige, das Zusammengesetzte.“ (Kristeva 1980: 12, Übersetzung: JB).
Mit Ekel-Lust erkunden Kinder ihre glitschigen und gammeligen Dinge und betreten damit ein Reich, das zwischen Ich und Ding, zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Wirklichkeit und Phantasie nicht zu trennen vermag.
Zeigen und Verstecken: Freuds Fadenspule
Eine Beobachtung Freuds ergänzt diese Dynamik kindlichen Sammelns um das Spiel von Präsenz und Absenz. In Jenseits des Lustprinzips (1920) beschreibt der Gründer der Psychoanalyse das eigenwillige Gebaren eines 18 Monate alten Kindes. Sobald dessen geliebte Mutter das Haus verlässt, wirft es eine Spindel mit einem lauten „o‑o-o‑o” fort, um sie dann am Faden wieder zurückzuholen und freudig mit „da” zu begrüssen.
„Ich merkte endlich, dass das ein Spiel sei und dass das Kind alle seine Spielsachen nur dazu benütze, mit ihnen ‚fortsein‘ zu spielen. Eines Tages machte ich dann die Beobachtung, die meine Auffassung bestätigte. Das Kind hatte eine Holzspule, die mit einem Bindfaden umwickelt war. Es fiel ihm nie ein, sie zum Beispiel am Boden hinter sich herzuziehen, also Wagen mit ihr zu spielen, sondern es warf die am Faden gehaltene Spule mit großem Geschick über den Rand seines verhängten Bettchens, so dass sie darin verschwand, sagte dazu sein bedeutungsvolles o‑o-o‑o und zog dann die Spule am Faden wieder aus dem Bett heraus, begrüßte aber deren Erscheinen jetzt mit einem freudigen ‚Da‘. Das war also das komplette Spiel, Verschwinden und Wiederkommen … “ (Freud 1940: 12).
Mit dieser ersten „großen kulturellen Leistung” erlangt für Freud das Kind seine Unabhängigkeit von der Mutter. Es ist ihr Verschwinden und Wiederkommen, welches das Kind spielerisch in Szene setzt – letztlich, um über die mütterliche An- und Abwesenheit selbst zu bestimmen. In Fort-Da-Spielen wird das Kind autonom. Es eignet sich Welt und sogar Worte an, indem es Dinge hervorholen und wegtun kann, wann immer es will. Bei Freud bleibt diese Selbstbestimmung jedoch stets an einen Mangel geknüpft: das Verlassenwerden von der Mutter. Für den Psychoanalytiker wird die „Passivität des Erleidens” hier in eine „Aktivität des Spielens” gewendet.
Hervorholen und verbergen, ordnen und verwerfen – mit diesen Bewegungen herrschen Kinder über ihre angesammelten Dinge.
Diesem traurigen Kern von Freuds Theorie muss nicht folgen, wer nach dem Muster des Fort-Da-Spiels kindliches Sammeln erhellen will. Doch kann die Lust am Verschwindenlassen und In-Unordnung-Bringen damit vertieft werden. Augenscheinlich geht es den Kindern bei ihren Sammelspielen nicht allein ums Zusammentragen und Präsentieren der Objekte. Genauso gerne lassen sie ganze Kollektionen verschwinden. Mattheo bewahrt seine toten Tiere in einem Eimer auf und hat vor allem Spaß dabei ihn „randvoll“ zu machen, um mit jedem neuen Stück die gesamte Sammlung umzuschichten. Franziska spielt mit den Filly-Pferden nicht, um sie ins pinke Fantasieschloss einziehen zu lassen, sondern, um sie einzeln in einem kleinen Köfferchen in ihrem Schrank zu verstauen (Duncker et al. 2014). Hervorholen und verbergen, ordnen und verwerfen – mit diesen Bewegungen herrschen Kinder über ihre angesammelten Dinge. Sie verstecken, verstauen oder vernichten sie, um aus den Resten neue Sammelordnungen erstehen zu lassen.
Fernab von der Konvention Erwachsener, entstandene Sammlungen um jeden Preis zu erhalten, üben sich Kinder also im Spiel um die Präsenz und Absenz gesammelter Arrangements – so, als ob jede Sammlung dem Rhythmus von „fort” und „da” gehorchte.
Form und Inhalt: Benjamins Strumpf
In seinen autobiographischen Notizen Berliner Kindheit um neunzehnhundert (1950) schildert Walter Benjamin die Sammelleidenschaft seiner Jugend. Jeder Stein, jede gepflückte Blume und jeder gefangene Schmetterling waren für ihn der Anfang einer Sammlung und alles, was er besaß, machte für ihn eine einzige Sammlung aus (ibid.: 90). Dem Kind Benjamin, so reflektiert der Erwachsene, lag dabei wenig daran, Neues zu erhalten; vielmehr wollte er Altes erneuern. Mit den banalsten Gegenständen suchte er eine Welt voller Möglichkeiten zu erschaffen. Beispiel hierfür sind die gefalteten Strümpfe, die Benjamins poetische und philosophische Auseinandersetzung mit der Welt versinnbildlichen.
So schildert der Erzähler, wie es ihn als Kind immer wieder zur Kommode zog, in der der Schatz verborgen war. Dabei drang er „so tief wie möglich” in das Innere des Möbels ein, wühlte sich vor, bis er die weiche, wollene Masse eines Strumpfpaars erspürte. Voller Aufregung begann er sie auszuwickeln. Doch was er letztlich in den Händen hielt, war eigentlich: nichts. Bestürzt musste er jeweils feststellen: „Form und Inhalt, Hülle und Verhülltes” erweisen sich als ein- und dasselbe.
„Ich musste mir Bahn bis in ihre hintersten Winkel schaffen; dann stieß ich auf meine Strümpfe, die da gehäuft und in althergebrachter Art gerollt und eingeschlagen ruhten. Jedes Paar hatte das Aussehen einer kleinen Tasche. Nichts ging mir über das Vergnügen, die Hand so tief wie möglich in ihr Inneres zu versenken. … Denn nun machte ich mich daran, ‚Das Mitgebrachte‘ aus seiner wollenen Tasche auszuwickeln. Ich zog es immer näher an mich heran, bis das Bestürzende sich ereignete: ich hatte ‚Das Mitgebrachte‘ herausgeholt, aber ‚Die Tasche‘, in der es gelegen hatte, war nicht mehr da. Nicht oft genug konnte ich die Probe auf diesen Vorgang machen. Es lehrte mich, dass Form und Inhalt, Hülle und Verhülltes dasselbe sind“ (Benjamin 2010: 58).
Im Bild der leeren Strumpftasche rekonstruiert Benjamin die magische Übereinstimmung zwischen kindlichem Denken und gegenständlicher Welt. Darin hören Socken auf, Socken zu sein und Kommoden, Kommoden. Stattdessen erlangen Aufbewahrungsort und Objekt einer Sammlung ein fast unerschöpfliches Entdeckungspotential. Immer wieder stülpt das Kind den Strumpf um, obwohl es weiß, dass es in ihm nichts zu finden gibt. Benjamins Strumpf wird so zum Symbol eines „vergeblichen Sammelns”(Finkelde 2006), dessen Zweck allein in der Wiederholung liegt.
Sammeln, nicht Sammlungen
Vorbei sind die Zeiten, die den kindlichen Sammel- und Besitztrieb als pathologisch verdächtigten. Selbst die Pädagogik begreift das leidenschaftliche Anhäufen von Dingen inzwischen als eine Form der Ich-Bildung. Allerdings sehen Kinderforscher wie Ludwig Duncker darin auch eine Gefahr: Gerät das infantile Sammeln unter die Räder einer allzu zielgerichteten Didaktik, schüttet man das Kind mit dem Bade aus. Es droht die Verwechslung von Sammeln und Sammlungen.
Bei den versteckten und versunkenen Spielen der Kleinen mit ihren Objekten geht es nicht in erster Linie um die Generierung von Wissen und Sozialkompetenz. Es geht darum, etwas in den Händen zu halten und es wieder verschwinden zu lassen. Fort-Da. Das Gesetz des Zufalls, die Ekel-Lust am Abjekten, das Spiel von Präsenz und Absenz sowie das vergebliche Suchen sind zwar höchst heterogene Elemente, doch eben sie sind die Merkmale kindlichen Sammelns – und stehen jeder repräsentativen Sammlung entgegen.
Literatur
Benjamin, Walter. 1950 [2010]. Berliner Kindheit um neunzehnhundert. Sonderausgabe mit einem Nachwort von Theodor W. Adorno. Berlin.
Duncker, Ludwig; Hahn, Katharina; Heyd, Corinna. 2014. Wenn Kinder sammeln: Begegnungen in der Welt der Dinge. Seelze.
Duncker, Ludwig. 2018. Wege zur ästhetischen Bildung. Anthropologische Grundlegung und schulpädagogische Orientierungen. München.
Finkelde, Dominik. 2006. „Vergebliches Sammeln. Walter Benjamins Analyse eines Unbehagens im Fin de Siècle und der europäischen Moderne“, arcadia 41.
Freud, Sigmund. 1920 [1940]. Gesammelte Werke Bd. XIII. Frankfurt am Main.
Kristeva, Julia. 1980 [1982]. Powers of horror. An essay on abjection. New York.
Lindgren, Astrid. 1945 [1986]. Pippi Langstrumpf. Hamburg.
Montessori, Maria. 1967 [2010]. Kinder sind anders. Stuttgart.
Wilde, Denise. 2015. Dinge sammeln: Annäherungen an eine Kulturtechnik. Bielefeld.
Bildnachweis
„Barrette-Collection“ von Jim Golden, jimgoldenstudio.com.
uncode-placeholder
Julia Boog
Julia Boog hat Germanistik und Kunstgeschichte an der Universität Hamburg studiert. Ihre Doktorarbeit widmete sie dem Witz der Differenz in der Migrationsliteratur u. a. von Felicitas Hoppe und Yōko Tawada. Derzeit lebt und arbeitet sie in Wien. (Foto: Rebecca Hoppe)







Geht es beim kindlichen Sammeln folglich auch darum etwas zu besitzen? Also etwas zu haben, dass einem selbst gehört und über das man selbst bestimmen kann im Sinne der „Fort-Da“-Logik. So gesehen lernen die Kinder im Sammeln die Logik von Eigentum. Interessant wäre hier, ob kindliches Sammeln etwas ist, dass sich überall gleich präsentiert, oder ob es sich in den verschiedenen Winkeln dieser Welt unterschiedlich getsaltet und inwiefern dies mit den gesellschaftlichen Bildern und Praxen von Besitz zu tun hat.
Liebe Gwendolyn Gilliéron, das wäre tatsächlich sehr interessant. Es gibt, glaube ich, noch keine interkulturell vergleichenden Studien zum kindlichen Sammeln. Sowieso gibt es allgemein noch sehr wenige empirische Studien. Ludwig Duncker und seine Mitarbeiter sind da echte Vorreiter. Bei Freud geht es insofern um Besitz, als dass sich das Kind mit der Spule gegenüber der Mutter ermächtigt: Es hat hier sozusagen ihr Leben in der Hand. Ihr Wegsein und Wiederkommen. Es geht Freud aber nicht um den tatsächlichen Besitz des Objektes „Spule“. Seine ‚Ökonomie‘, wie er es selber nennt, ist eine abstrakte: Unlust in Lust zu verwandeln. Es wäre aber sicherlich interessant, auch im Sinne des material turns, nochmal genauer nach den Dingen, die hier zum Einsatz kommen, zu fragen. Danke für den anregenden Kommentar!
Das ist ein sehr interessanter und auch spannend zu lesender Beitrag zum Sammeln im Kindesalter. Er bereichert die Diskussion um einige psychoanalytisch motivierte Aspekte, die erklärungskräftig sind, aber wohl nicht in jedem Einzelfall das Sammelverhalten erklären. Die Lust an der Unordnung, am Schmutzigen und Ekligen wird oft überlagert (oder verdrängt?) durch eine erstaunliche Lust daran, Ordnung zu schaffen und die Dinge schön und übersichtlich zusammenzustellen. So kann wohl Ordnen und Umordnen als eine wechselseitige Dynamik begriffen werden, in der sich vielfältige Bildungsprozesse abbilden. Übrigens zeigt auch die erste Illustration zu diesem Text eine sehr artifizielle farbliche Ordnung, mit der die Dinge – kontrapunktisch zum Titel des Textes – aufgereiht werden.
Man würde der Grundschule wahrscheinlich etwas Unrecht antun, wenn man sie pauschal dem Verdacht aussetzte, sie würde nur auf Abstraktion und Sinnenleere setzen. Begriffe bilden, allgemeine Aussagen erarbeiten, Gesetzmäßigkeiten erkennen usw. sind bestimmt wichtige Aspekte, die zum schulischen Lernen gehören. Und manchmal geht sicher auch der Bezug zum Anschaulichen und Konkreten zu schnell verloren. Aber gerade im Sammeln zeigt sich auch ein methodisches Potenzial, den wechselseitigen Bezug zwischen Besonderem und Abstrakten, zwischen Einmaligem und Allgemeinem in beide Richtungen zu überschreiten und so wertvolle Bildungsanlässe zu schaffen.
Lieber Ludwig Duncker, Sie haben sicherlich recht, dass die Ordnung beim ‚Unordnen‘ mitgedacht werden muss. Da sich der Artikel vor allem mit dem psychoanalytischen ‚Lust- und Unlustprinzip‘ im kindlichen Sammeln auseinandersetzt, geht dieser Aspekt etwas verloren. Ich würde auf keinen Fall gegen den hohen Wert von Sammlungen im Bildungsprozess sprechen. Ob an der Schule oder im Kinderzimmer. Aber, wie sie selbst ja auch in ihrem Buch betonen, geht es primär darum, genügend Freiräume zu lassen, die in der Schule vielleicht noch schwieriger umzusetzen sind als im direkten Verhältnis mit den Eltern. Es war ein unglaublich spannender Fund in ihrem ‚Sammlungsbuch‘, wie stark Kinder mit zufällig und oft auch ‚abfällig‘ Gefundenem umgehen, und dass sie sich teilweise sogar direkt gegen ökonomische Ziele richten: Ihre Sammlungen dürfen nichts kosten, weder materiell noch zeitlich. Auch wenn sie dann hunderte Stunden in die Reinigung ihrer Objekte und das Spiel mit ihnen stecken, soll die Anschaffung fast eine schicksalhafte sein. Und genau das findet man wieder bei Walter Benjamin und auch bei Pippi Langstrumpf. Hier zeigt sich eine poetische, geradezu magische Verbindung der Kinder mit ihrer Außenwelt, die die pädagogischen Motive vielleicht etwas überschreitet, aber sie keinesfalls nivelliert. Haben Sie vielen Dank für Ihren Kommentar! Vielleicht können Sie sogar ein konkretes Beispiel nennen, wie Sie Sammlungen in der Schule einsetzen?
Liebe Julia Boog-Kaminski, eine Didaktik des Sammelns ist bislang noch nicht ausgearbeitet worden. Sie hätte aufzuzeigen, wie aus der anschaulichen Begegnung mit den Dingen des Alltags allgemeinere Erkenntnisse gewonnen werden können. Sammeln wird dabei zu einer Methode, die das Zusammentragen, Sichten und Ordnen von Materialien und Gegenständen für Bildungsprozesse erschliessen. So können beispielsweise einfache Formen des journalistischen und wissenschaftspropädeutischen Arbeitens mit Sammelaktivitäten verknüpft werden. Das Sammeln von Blättern, Gräsern und Zapfen verschiedener Nadelbäume sensibilisiert für die Vielfalt unterschiedlicher Pflanzen. Das Zusammentragen von Informationen ist auch im journalistischen Arbeiten oft der Beginn, um Fragen aufzuwerfen und sich ein Bild von einem Thema zu machen und dabei vielleicht auch auf Probleme zu stoßen. Auch eine Chronik über vergangene Zeiten, zum Beispiel über das Sammeln von alten Postkarten oder von alten Zeitungsartikeln kann im historischen Lernen Anschaulichkeit stiften. Ein Lehrer hat einmal mit seinen Grundschülern ein Päckchen zusammengestellt mit Dingen, die einer späteren Schülergeneration verdeutlichen soll, was den Kindern wichtig ist. Auch im Kunstunterricht werden oft Materialien gesammelt, aus denen dann neue Objekte hergestellt werden, zum Beispiel aus Abfallmaterialien oder aus Schrott. Kunstwerke entstehen oft durch die Umdeutung unbrauchbar oder nutzlos gewordenen Dingen, nicht nur bei der Herstellung von Robotern aus alten Joghurtbechern. Auch viele Gemälde von Arcimboldo sind eigentlich neue Arrangements von „gesammelten“ Früchten.
Kleber, Sticker, Panini… kaum ein anderes Sammelartefakt ist unter Kindern (im Primarschulalter) so beliebt wie die hyper-kommerzialisierten Kleberkollektionen. Hier scheinen zwei Aktivitäten im Vordergrund zu stehen:
A)Die Ein- und Ausübung des geschickten Tauschhandels im Sinne einer eigenmächtigen Früh-Sozialisation in die nicht monetär regulierten Aspekte der Marktgesellschaft
B) Präzise das Gegenteil von „Unordnung und Vernichtungswille“, nämlich das Ausüben eines Vervollständigungs- oder Perfektionsdrang mit dem Ziel der Vollständigkeit des Sammelbandes (die Lücken dessen für die/den junge/n Sammler/in den zu erwerbenden Artefakten erst ihren Wert beimisst).
Die Pragmatik und Pedanktik von Panini-Kindern ist nachgerade schockierend.
Lieber Herr Duncker, dieses Erschrecken formulieren Sie ja auch in Ihrem ‚Sammelbuch‘ und zeigen, dass das kommerzielle Sammeln seit 2000 unglaublich stark zugenommen hat. Vor allem weil der Markt selbst es immer mehr als Mittel entdeckt, an die Brieftaschen der Eltern zu kommen. Aber gerade die Panini- und Pokémon-Kinder sind es ja, die einem oberflächig auf- und einfallen. Dagegen findet man in ihrem Buch jedoch nicht nur ‚Abjektes‘ sammelnde Kinder, sondern beobachtet selbst die kommerziell sammelnden Kleinen bei ganz individuellen Spielen mit ihren Kaufobjekten: Wie die beiden Mädchen mit den Filly-Pferden. Die Eine baut sie überall im Raum verstreut auf, mischt sie mit anderen Figuren; die Andere hat vor allem Lust daran, die Pferdchen ein- und auszupacken. Dafür nutzt sie zwar extra dafür vorgesehene Köfferchen, aber sie wickelt sie so behutsam in kleine Tüchlein und verstaut sie in ihrem Schrank, dass sie mich stark an die Benjamin Kinderfigur erinnert hat. Wie Benjamin betont ist die Seele des Spiels hier nicht ein „So-tun-als-ob“, sondern ein „Immer-wieder-tun“. Eine Art Wiederholungsdrang, in dem erstmal nichts genuin Sinnstiftendes oder Nützliches geschaffen, sondern gespielt, geliebt und ‚verworfen‘ wird. Das finde ich ungemein spannend.
Vielen Dank für diesen interessanten Beitrag! Dieses Thema erinnert mich stark an die Sammelpraxis der Surrealisten ab den 1920er Jahren, die Wert auf das „zufällige“ Finden von Sammelobjekten und auf Heterogenität ihrer Sammlungen legten. Das Interesse lag bei Objekten, die eine besondere Geschichte in sich trugen, daher erwarben sie vieles auf Flohmärkten. Das Ding galt als Vehikel, um der Phantasie zum Ausstieg aus der Alltäglichkeit zu verhelfen, bzw. das Wundersame im Alltäglichen zu zeigen. Zugleich idealisierten sie in ihrer Kunstauffassung insgesamt den vermeintlich irrationalen Zugang von Kindern zu Kreativität und Phantasie. Ihre Sammlungen wurden allerdings anders als bei den Kindern sehr wohl geordnet, arrangiert, re-arrangiert und gezeigt. Bei Freud haben die Surrealisten sich ja auch sehr viele Anleihen gemacht. Es ist sehr erhellend, wie Sie die kindliche Sammelpraxis auch entlang von Freud und Benjamin beleuchten, allerdings würde ich die freudsche Psychoanalyse nur mit Vorsicht als Erklärmodell heranziehen. Übrigens sprach Benjamin für die Surrealisten von einer „profanen Erleuchtung“, die sich in einer „materialistischen Inspiration“ manifestiere, d.h. in der Suche nach dem Ding.
Liebe Nana Kintz, das ‚objet trouvé‘ in Dada- und Surrealismus hat sicher viele Anleihen bei der kindlichen Sammelpraxis gemacht. Und diese idealisiert. Einer Idealisierung entgegenzuarbeiten, scheint mir dagegen wieder mit Freud möglich: Er sieht in der ‚Magie‘ der Kinder auch ihre Abgründe lauern. Ebenso wie Benjamin, der beim Sammeln und Spielen stets den „dunklen Drang der Wiederholung“, namentlich den Wiederholungszwang heraushebt, und damit auf Freud’s Todestrieb anspielt. Diesen arbeitet der Psychoanalytiker in „Jenseits des Lustprinzips“ aus, also eben jenem Werk, in dem das Fort-Da-Spiel beschrieben wird. Todes- und Spieltrieb – bei Walter Benjamin und Sigmund Freud bilden sie einen unvermeidlichen Konnex, aber natürlich sollte auch dieser Zusammenschluss das Sammeln bei Kindern nicht einseitig ‚verdunkeln‘. Surrealistische Technik bzw. allgemein künstlerische Praxis können einen weiteren erhellenden Blick auf das Phänomen werfen. Hier wäre dann auch Benjamins Theorie von der „Mimesis“ und „Physiognomie“ interessant. Für ihn sind die Surrealisten ja auch „Seher und Zeichendeuter“. Danke für Ihre Anregung!