Amerika im Juli 2016. Die Grand Old Party schickt einen erstaunlichen Kandidaten ins Rennen um die Präsidentschaft der USA. Der Weltöffentlichkeit präsentiert sie einen auffällig frisierten Mann mit einer Neigung zu Gold, Glitzer und schönen Frauen. In den kommenden Monaten wird dieser hemmungslos lügen, bluffen, ständig seine Meinung wechseln – ohne in der Gunst der Wähler zu sinken. Derweil hat seine demokratische Konkurrentin Hillary Clinton über ihre Einkünfte, Steuern und E‑mails Rechenschaft abzulegen, ohne dass von dieser Rechtschaffenheit jemand Notiz nimmt.
Entsprechend war die Rede von einer postfaktischen Politik, bei der alles andere, nur die Tatsachen nicht zählen. Doch warum, so haben wir die Amerikanistin und Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen gefragt, kann ein offensichtlicher Hochstapler wie Trump überhaupt eine derartige Position erlangen?

Elisabeth Bronfen beginnt das Gespräch mit einem Zitat aus Trumps Autobiographie The Art of the Deal:
„I play to people’s fantasies. . . . People want to believe that something is the biggest and the greatest and the most spectacular. I call it truthful hyperbole.“ (Trump und Schwartz 1987)
Eine solche Hyperbel, eine derartige Übertreibung aber, so Bronfen, könne ja nicht wahrhaft sein. Das sei ein Widerspruch in sich selbst. Allerdings dürfe man dabei einen Aspekt nicht ausser Acht lassen, den Umstand nämlich, wonach Menschen glauben wollen. „People want to believe“.
Avenue: Wenn wir Hochstapler in Europa betrachten, dann geht es um Schichten, um Stratifikation. Wie steht es um den amerikanischen Hochstapler? In welchem Verhältnis steht beispielsweise das con game mit der Hochstapelei?
Elisabeth Bronfen: Über dieses Verhältnis habe ich auch nachgedacht. Es gibt nämlich keine deutschsprachigen Texte zu der Art von Hochstapelei, die mich interessiert. Wer hochstapelt, gibt vor etwas zu tun oder zu können, was er eigentlich nicht kann. Er hängt den Scheffel nicht zu tief, sondern zu hoch.
Das amerikanische ‚con game‘ dagegen geht auf ‚confidence game‘ zurück. In dem Begriff confidence liegt der Begriff trust. Der entscheidende Punkt im amerikanischen Verständnis des confidence man oder des con game liegt im Vertrauen, das der Andere oder man selbst in eine Art Tausch untereinander steckt. In der amerikanischen Kultur beginnt die Geschichte der confidence games bereits mit den Puritanern. Letztlich ist das ganze amerikanische Projekt ein Spiel mit dem Vertrauen in das Versprechen: ‚Wir gehen nach Amerika und werden dort die Bibel erfüllen.‘
Doch möglicherweise gehe ich da zu weit zurück. Ich starte deshalb um 1800 – mit der Idee des Selbstentwurfs, der so wichtig für den amerikanischen Subjektivitätsbegriff, den amerikanischen Individualismus ist. Als ersten grossen con man würde ich Benjamin Franklin sehen, der sich in seiner Biografie zu etwas entwirft. Das ist in seinem Fall keinesfalls bösartig.
Avenue: Beinhaltet das amerikanische Recht auf den pursuit of happiness, dass wir Wetten auf die Zukunft eingehen, in die wir andere einbinden – selbst auf die Gefahr hin, dass die Wetten sich als Betrug herausstellen? Ist das Glückstreben ein Glücksspiel?
Bronfen: Zum amerikanischen con man gehört von Anfang an, dass andere bereit sind, an Träume zu glauben, von denen sie wissen: Sie sind nicht realisierbar. Die Bauern, die Handwerker, die Gouvernanten des ausgehenden 18. Jahrhunderts in Europa wussten, dass sie nie aufsteigen würden. Amerikaner dagegen glauben bis heute, auch wenn es keinerlei Anlass dafür gibt, sie könnten aufsteigen. Wenn man Amerikaner fragt, wer glaube, dass er zu Lebzeiten Millionär werde, sagen 98 Prozent, sie könnten sich das für sich vorstellen. Dabei gelingt das vielleicht nur einem Prozent. Realität und Selbstvorstellung klaffen auseinander. In diese Lücke tritt in Amerika der con man. Das heisst, confidence games haben nicht nur etwas mit trust zu tun, sondern auch mit „people want to believe“. Das gilt nicht in gleicher Form für europäische Hochstapler wie Felix Krull. Der Selbstbetrug der Amerikaner ist lustvoll, offen und freiwillig.
Der Selbstbetrug der Amerikaner ist lustvoll, offen und freiwillig.
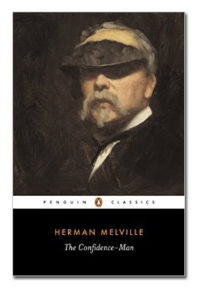
Der entscheidende Hochstaplertext des 19. Jahrhunderts ist Hermann Melvilles The Confidence Man – eine Kritik an Ralph Waldo Emerson mit seinen ganzen Vorstellungen von self reliance und self determination. Diese sah Melville als riesig grossen con act an. Erzählt wird von einer Reise auf einem Dampfer, der langsam den Mississippi hinunterfährt, wobei sich die Mitfahrenden – möglicherweise sind sie auch einfach Teil einer einzigen Persönlichkeit – unterhalten. Melvilles con man gewinnt nichts, kein Geld, kein Ansehen, er macht es einfach aus Lust am Spiel. Das ist sehr undeutsch.
Avenue: Kann man in Europa also eher von einer vertikalen Hochstapelei sprechen in Hinblick auf den Aufstieg in der sozialen Schicht – und in den USA von einer ‚horizontalen Hochstapelei’, einer Hochstapelei in die Zeit, in die Zukunft hinein?
Bronfen: Nun, die grossen Hochstapler in der amerikanischen Popkultur der Gegenwart wie im Film The Wolf of Wall Street (Scorsese 2013) wollen schon aufsteigen. Der Amerikanische con man ist die Übertreibung des amerikanischen Traums, der einem verspricht, Wohlstand zu erlangen, sich selbst zu definieren. Confidence men und confidence women treiben dies auf die Spitze und ad absurdum; ihr Aufstieg beruht auf Fiktionen. Sie spielen mit diesem Vertrauen in eine Kultur, in der Aufstieg grundsätzlich möglich wäre – anders als in der europäischen Klassengesellschaft.

Avenue: Das normale Curriculum eines Amerikaners weist also eine Wachstumskurve auf?
Bronfen: Das sollte so sein. Die weissen Männer, die jetzt Trump wählen, sind verärgert darüber, dass diese Kurve für sie nicht stimmt.[optin-monster-shortcode id=„dt9rsfvwqpi1fje5qsi0“]
Avenue: Uns interessiert der Hochstapler als Kippfigur; wenn er auffliegt, legt er gleich auch das Funktionieren von Gesellschaft offen. Am Anfang unserer Beschäftigung mit Hochstaplern hatten wir eine Podiumsdiskussion mit den Beltracchis, den Kunstfälschern. Mit den Beltracchis flog auch gleich das System des Kunstmarktes auf – dieses Investieren in Kunst in der Hoffnung, dass sie noch teurer wird, die künstliche Verknappung von Werken, der fehlende Anreiz, Fälschungen als solche zu entlarven. Als die Beltracchis aufflogen, hat die Welt natürlich gelacht, auch anerkennend aufgrund der stupenden Technik, mit der das Pärchen gearbeitet hatten. Doch einher ging dies mit einem stark moralisierenden Blick auf’s System. Das scheint beim amerikanischen con game anders zu sein …

Bronfen: Mir fällt keine amerikanische Entsprechung ein; ich glaube, bei den Amerikanern geht es entweder um den American Dream mit freedom, prosperity and happiness oder ums Psychologische: Das heisst, um diese sehr amerikanische Vorstellung von individueller Identität, von Selbsterfindung, Selbstdarstellung, Selbstverkauf – Vorstellungen, in denen man selber zur Wahre wird. Je weniger da ist, desto mehr kann man sich erfinden. Beispielsweise ist The Great Gatsby eigentlich niemand. Entsprechend produzieren die Leute Phantasien. Das sind psychologische Geschichten. Zur Idee, dass man an der Grenze ‚falsch vs. richtig’ spielt und vielleicht sogar das Richtige mit der Fälschung übertrifft, dazu kann ich gerade keine Texte aufrufen.
Je weniger da ist, desto mehr kann man sich erfinden.
Amerikanische con games in Filmen sind entweder streetwise, wobei irgend jemandem etwas sehr überzeugend erzählt wird. Oder aber es geht darum, dass jemand sehr viel Zeit investiert, um etwas vorzugeben, das aber eigentlich nicht so ist wie etwa im Film Ocean’s Eleven (Soderbergh 2001). Einige dieser Filme sind ausserdem Filme über Filme. In Catch Me If You Can (Spielberg 2002) wird immer auch vorgeführt, dass Kino eine Illusionsmaschine ist. Ausserdem haben einige dieser Filme mit Immigration zu tun. Catch Me If You Can ist für mich auch eine jüdische Geschichte. In der amerikanischen Literatur gibt es den Trickster, in der jüdisch-amerikanischen Literatur den Hersch Ostropoler, der vorgibt, etwas zu sein und unendlich viele Geschichten erzählen kann. Es geht um Figuren, die vom Rand der Gesellschaft in ihr Zentrum vordringen wollen. Es gelingt ihnen, weil das in der amerikanischen Gesellschaft legitim ist und die Frage nach der Vergangenheit niemanden interessiert: ‚Who cares about the past?‘
Avenue: So?
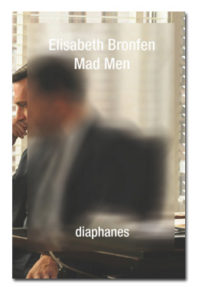
Bronfen: Genau. Donald Trump lügt, wenn er sagt, sein Vater sei ein Schwede und er selbst sei in New Jersey aufgewachsen. In Wirklichkeit ist Trump nämlich der Sohn deutscher Einwanderer aus der Bronx. Ich denke aber auch an Don Draper in der Fernsehserie Mad Man, der sich eine neue Identität aneignet. Am Ende der 7. Staffel, in der er endlich seine wahre Identität gesteht, sagen die Leute ‚who cares?‘.
Avenue: Uns dünkt, die verschwiegene Wahrheit in Don Drapers Vergangenheit habe immer etwas Bedrohliches; sie scheint ihm immer wie eine Rachegöttin hinterher zu schleichen – wenigstens für den europäischen Betrachter.
Bronfen: Mir kommt da ein Roman von Edith Wharton in Sinn: The House of Mirth (1905). Die junge Heldin ist ebenfalls eine Hochstaplerin, die letztlich auch auffliegt. Mich interessieren an der amerikanischen Kultur immer Gegensätze. Dem Gebot „Ich muss mich neu und selbst entwerfen“, „Ich bin das Image, das ich produziere, der Effekt, den ich habe“ steht die amerikanische Tugend der Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit entgegen. Zitiert wird stets der ‚grösste‘ amerikanische Präsident, George Washington, mit seinem „Sir, I cannot tell a lie.“ Dieses Gebot zur Wahrhaftigkeit wurde Bill Clinton damals im Impeachment fast zum Verhängnis, als er seine sexuelle Beziehung zu seiner Praktikantin nicht zugegeben wollte.

Das heisst, in den grossen sozialrealistischen Texten Amerikas, zum Beispiel bei Theodore Dreiser, werden die Helden zunächst von ihrer Vergangenheit eingeholt, um sie dann zu überwinden. Bei Don Draper in Mad Man beobachten wir eine Gegenläufigkeit: Nach aussen ist alles auf die Zukunft ausgerichtet. Innerlich aber wird er immer in die Vergangenheit gezogen.
Avenue: Entsprechendes hat uns an Trump interessiert. Die Lüge scheint eine ganz andere Rolle zu spielen. Niemanden interessieren die ganzen Skandale, die nicht deklarierten Steuern. Dagegen scheint Hillary Clinton ganz und gar auf einen europäischen Wahrheitsdiskurs verpflichtet zu werden.
Bronfen: Nun, ich gebe zu: I always was with her and I am with her. Clinton steht innerhalb des Kontextes doch für eine politische Redlichkeit. Klar hat Politik mit Kompromissen zu tun. Doch sie legt verhältnismässig offen, was sie tut. Sie steht für bestimmte Dinge ein, engagiert sich für Benachteiligte, die Afroamerikaner, die Frauen. Sie ist eine politician of compassion and sincerity. Natürlich versucht eine Frau, die immer von der Presse so fertig gemacht wurde, Dinge zu verbergen. Ich denke, sie unterscheidet zwischen privatem und öffentlichem Wissen: Muss die Öffentlichkeit wissen, dass sie eine Lungenentzündung hat? Und auch wenn sie schon vor drei Jahren angesichts der gelöschten E‑mails gesagt hätte: „Oops, I made a mistake“ – hätte man es ihr verziehen? An dieser Stelle sei also an Clintons sincerity festgehalten.
Bei Trump dagegen zählt nichts. Die Masse an Lügen, die er immerzu produziert, ist wirklich erstaunlich. So haben wir amerikanische Politik noch nicht erlebt. An Trump können wir tatsächlich beobachten „Ich bin nur mein Image – und wenn ich das gut genug vermarkten kann, dann ist es das auch.“. Trump kann einfach behaupten, er sei gegen den Irak Krieg gewesen. Sofort twittern die Leute seine Worte. Niemand schert sich dabei um Lüge und Wahrheit. Warum? Es kann damit zusammenhängen, dass Trump eine Reality TV Persönlichkeit ist. Es ist erschütternd, dass Präsident Obama ernsthaft daran erinnern muss, dass „it’s NOT reality TV“. Dass wir das überhaupt diskutieren müssen!
Avenue: Hat die Verpflichtung zur Wahrhaftigkeit auch etwas mit Gender zu tun?
Bronfen: Ja. Wenn ich zum Begriff con games recherchiere, dann finde ich kaum je etwas zu Frauen. Es gibt den Begriff con man. Doch con women verwende nur ich. Natürlich gibt es Hochstaplerinnen. Doch die confidence games gehören in den Bereich des Männlichen. Das hat mit alten Geschlechterrollen zu tun. Frauen stehen im Privaten, sie stehen für Vertrauen, Redlichkeit. Die Männer stehen im Bereich des Öffentlichen und für Risiko, Spiel und Bluff.
A propos Gender: Es gibt genügend weisse Männer und einige weisse Frauen, die Mühe haben mit der Vorstellung einer Frau an der Spitze des Heeres. Amerikanerinnen haben bis heute kein equal rights amendment; sie sind rechtlich schlechter gestellt als die Schweizerinnen. Es gab ein equal rights amendment für Schwarze, aber nie eines für Frauen.

Avenue: Im Moment kursiert der Begriff der postfaktischen Politik. Zitiert wird Rudolph Giuliani, der ehemalige Bürgermeister New Yorks, der behauptete, die ganzen Terroranschläge hätten sich erst ereignet, seit Obama an der Macht sei. Wir alle wissen, dass das nicht der Fall ist. Giuliani muss sich für seine Lüge nicht rechtfertigen, eher nimmt er in Anspruch, mit eben dieser Lüge eine verdeckte oder tiefer liegende Form der Wahrheit – eine Art Meinungs-Wahrheit – offenzulegen.
Bronfen: Ulrich Beck sprach darüber, dass wir seit zehn Jahren immer weniger Wert auf Expertentum legen. ‚Meinung‘ ist das entscheidende Wort. Wir beobachten den Zusammenbruch der zivilen Öffentlichkeit, der Autorität von Experten und selbst der Fakten, die in den 1990er und 2000er Jahren noch unhinterfragt Geltung hatten. Die Grenze zwischen distanzierter und differenzierter Berichterstattung und Meinung verschwimmt. Die New York Times unterscheidet zwar weiterhin zwischen Reporting und Editorial. Doch über die sozialen Medien kann irgendjemand überall seine Meinung kundtun – als gäbe es die Experten, die wirklich etwas über einen Sachverhalt wissen, gar nicht. In einer Welt, in der man nicht bereit ist, der Klasse, die über Wissen verfügt, die entsprechende Autorität zuzusprechen, haben Fakten keinen entsprechenden Stellenwert mehr. Es geht vielmehr um Empfindsamkeiten und um das, was man glauben will und nicht um das, was man wissen kann.
Nun tut Trump ja nicht so, als ob er nicht lügen würde. Er lügt bewusst und schamlos und wenn man ihm sagt, das war gelogen, dann rechtfertigt er sich nicht, sondern er sagt einfach etwas anderes. Er kann sich innerhalb weniger Sätze diametral widersprechen. Die Realität ist völlig fiktional geworden.
Avenue: Wir hatten uns auch gedacht: Trump verführt damit, dass er vorführt, wie er verführt.
Bronfen: Genau. Was Trump tut, ist sehr ‚meta‘. Trump ist die logische Konsequenz von der schlechten Seite der Postmoderne. Er ist schieres Simulacrum, das von sich sagt, ‚ich bin ein Simulacrum‘. Wenn man die vom Ghostwriter Tony Schwartz geschriebene Autobiograhie von Trump liest, hat man den Eindruck, Trump sei wirklich nur Image. Da ist nicht einmal mehr ein Ego dahinter.
Trump ist die logische Konsequenz von der schlechten Seite der Postmoderne.
Avenue: Sie haben in Ihrem Buch über Mad Man beschrieben, wie Don Draper den Schokoriegel Hershey’s Bar bewirbt – mit einer erlogenen und einer wahren Kindheitsgeschichte. Bei beiden Geschichten stellt sich für die Zuhörer dieses nostalgische Gefühl ein, das Hershey’s Bar unwiderstehlich macht. Wir haben uns gefragt, ob Donald Trump sich ebenfalls als eine nostalgische Figur aufbaut: Nämlich als einen von allen Institutionen befreiten selfmade man – als letzten Cowboy-Souverän, der jenseits aller Behörden und Bürokratien über den Ausnahmezustand verfügen darf.
Bronfen: Trump ist ein Arbeiterkind, ein Kind von Einwanderern; der Vater war schlicht ein Slumlord, der Millionen damit verdient, dass er arme Leute in schrecklichen Wohnungen noch ärmer werden lässt. Slumloard bedeutet letztlich Geld auf Kosten der Allerärmsten. Trump kommt also nicht aus dem alten amerikanischen Geld. Er würde wahnsinnig gerne anerkannt werden, doch er kann tun, was er will – nie, nie akzeptieren ihn die Kennedys und Vanderbilts: Hier liegt die Lücke des Begehrens. Er ist eine hässliche Version von Gatsby – minus der wunderbaren Daisy. Also macht Trump jetzt seine eigene Form von käuflicher Aristokratie, eine geschmacklose, extraarrogante Aristokratie des Neureichen, für die der goldene Trump Tower steht.
Trump ist ein Demagoge im Dienste seiner selbst.
Trump wäre tatsächlich gerne König oder gar ‚emperor of the world‘ – aber nicht, weil er ein politisches Projekt hat. Darin besteht der Unterschied zu den faschistischen Führern in Europa. Wenn sich in einer Debatte erweist, dass Trump Steuern hinterzogen hat, erklärt er sofort und schlagfertig: „That makes me smart“. Die Argumentation funktioniert wie bei den Marx Brothers, nur dass sie nicht komisch gemeint ist. Dabei geht es Trump nur darum, sich selbst zu bewerben; Trump ist ein Demagoge im Dienste seiner selbst. Der Rassismus, die Misogynie, das sind austauschbare, postmoderne Signifikanten. Allerdings nicht für die Leute, die von Trump begeistert sind.
Nostalgisch ist die Begeisterung für Trump auch aus folgendem Grund: Bei Politik geht es immer um Geld: Du gibst mir das und ich geb‘ Dir das. Die Leute aber glauben, Trump verfüge über so viel Geld, dass er nicht korrumpierbar sei. Letztlich fantasieren sie sich eine noch nicht vernetzte Welt hinein. Deshalb gehen zu den Gründervätern zurück, zu Mr. Washington, der mit seinen 12 Freunden verhandelt, in einer Zeit, in der es noch keine Banken gibt und auch keine internationalen Konzerne. Es geht um gentlemen rulers, hier nur mit sehr schlechtem Geschmack.
Avenue: Trump erinnert irgendwie an Ludwig II, den Märchenkönig von Bayern. Ihm scheint dabei eine gewisse Politikverdrossenheit oder eher: eine Institutionenverdrossenheit der Amerikaner in die Hände zu spielen. Und Clinton steht ganz und gar für Institutionen…
Bronfen: Nicht wenige Amerikaner hegen ein Misstrauen gegenüber Experten und Institutionen. Es geht nicht nur um Regulation, Deregulation, sondern um einen antiinstitutionalistischen, radikalen Individualismus. Und Frau Clinton, die seit 30 Jahren redliche Politik macht – mit allen Kompromissen –, steht aus Sicht vieler Amerikaner für die Institutionen. Die Tatsache, dass die Republikaner die Institutionen in den letzten acht Jahren kaputt gemacht haben, hilft wenig. Und daran, dass ihre Teaparty-Leute die Regierung zum Stillstand gebracht haben, erinnert sich die Partei heute schon nicht mehr.
Trump ist obszön und überbordend. Clinton dagegen ist sehr zurückhaltend. Ich bin erstaunt, dass die Presse das nirgendwo schreibt. Aber Clinton hat grace – in der doppelte Bedeutung von Grazie und Grosszügigkeit. Aber Trump hat dieses Obszöne, ich nutze den Begriff wie Slavoj Žižek, bei dem das Obszöne gegen das Gesetz vertösst. In der New York Times wurden diese immensen Schulden aufgedeckt; in den 90er Jahren hat Trump einfach Milliarden verspielt – ich weiss nicht, wieviele Menschen dabei zugrunde gegangen sind. Doch Trump hat gar kein Gefühl für Konsequenzen. Das aber begeistert die Leute! In ihren Augen steht Trump für Risikofreude – und die ist auch amerikanisch.
Avenue: Wenn man Žižek noch einmal ins Spiel bringt: Trumps Handeln scheint einer zynischen Ideologie zu entsprechen. Auf der Ebene des Sagens und Sprechens geht es darum, sich von Institutionen zu befreien, zu tun und zu lassen, wozu man Lust hat. Auf der verschwiegenen Seite des Handelns aber bedient man uramerikanische, fast barbarische Werte: Einehmen, Kolonisieren, Abschrecken. Dafür steht Trump zwar explizit nicht ein, aber er ‚praktiziert‘ diese Werte in der Art und Weise des Sprechens.
Bronfen: Trumps Sprechen ist tatsächlich performativ. Damit löst Trump auch diese Mobs aus. Mobs haben wir seit den 60er Jahren nicht mehr so deutlich gesehen – Aufmärsche, bei denen sogar die confederate flag, die Südstaatenflagge gehisst wird. Das ist jetzt wieder erlaubt. Und deshalb nenne ich Trumps Reden und Verhalten auch obszön, weil es in den Menschen das auslöst, was Freud das Barbarische nennt. Das aber hat nichts mehr zu tun mit Hochstapelei. Deshalb: Wir müssen unterscheiden zwischen Trump und den Leuten, die ihm folgen. Für die ist das real.
Avenue: Vielen Dank für das Gespräch.
Prof. Dr. Elisabeth Bronfen ist Kultur- und Literaturwissenschaftlerin an der Universität Zürich. Zudem ist sie seit 2007 Global Distinguished Professor an der New York University. Bronfen hat zahlreiche Aufsätze in den Bereichen Gender Studies, Psychoanalyse, der Literatur‑, Film- und Kulturwissenschaften sowie einige vielbeachtete Bücher veröffentlicht. Zuletzt erschien von ihr das Buch Mad Men (2015), in dem sie die gleichnamige Fernsehserie und ihren Protagonisten Don Draper historisch, literarisch und politisch in Kontext setzt. Mehr über Elisabeth Bronfen findet sich in der Wikipedia oder auf ihrer Homepage.
Das Interview wurde im Oktober 2016 von Corinna Virchow und Mario Kaiser geführt.
uncode-placeholder
Herausgeber*innen
Anmerkung: Die Herausgeber*innen der Avenue lancierten zu Weihnachten 2020 die Initiative Salz + Kunst als Antwort auf die Einschränkung des künstlerischen Lebens während der Corona-Pandemie. Im Sinne von art on demand vermittelt die Plattform Kunststücke nahezu aller Kunstsparten in den privaten Raum: ein Jodel im Vorgarten, ein philosophisches Gespräch per Zoom, ein Gedicht per Whatsapp, ein Violinkonzert auf dem Balkon …







Für mich war „con man“ immer negativ behaftet, die Etymologie weisst aber auf eine positive Eigenschaft hin. Wer möchte schon nicht „confident“ sein.
Ein „con man“ hat, oder vermittelt, aber zu viel davon.
Die kürzlich veröffentlichen Tonaufnahmen (in der NYT), dass Trump sich mit seiner eigenen Person gar nicht beschäftigen will. Nur mit seinem Image.
“No, I don’t want to think about it,” he said when Mr. D’Antonio asked him to contemplate the meaning of his life. “I don’t like to analyze myself because I might not like what I see.”
http://www.nytimes.com/2016/10/26/us/politics/donald–trump–interviews.html
Das ist jetzt aber sehr grosszügig. Clinton ist genauso kaltblütig wie berechnend. Wer sich an ihr «obszönes» Lachen über Gaddafis Tod erinnert, schaudert und fragt sich, ob die katastrophale Politik im arabischen Raum nicht Grund genug ist, einen Machtwechsel zu wählen.
Nun, weder Clintons Lachen noch ihr Ernst lassen mit absoluter Sicherheit auf ihr Inneres schliessen. Natürlich fällt in Clintons Zeit als Aussenministerin der Arabische Frühling und damit eine doch zunächst mit Hoffnung verbundene, wenngleich nur teils erfolgreiche Demokratisierungsbewegung. Auch stehen die Clintons wohl ebenso für Camp David, den Handschlag zwischen Arafat und Rabin und ein Bemühen um Frieden im nahen Ostens nach den ersten Golfkriegen. Also weder die Golfkriege, noch das Erstarken reaktionärer / totalitärer Kräfte (nicht nur) im arabischen Raum, noch das Scheitern einer friedlichen Lösung des Palästina-Konflikts sind ausgerechnet Hillary Clinton anzulasten.
Kann also eine – durch mögliche und auch gegensätzliche Emotionen bestimmte – Momentaufnahme für ein gesamtes politisches Programm stehen? Man kann Clintons politischem Bestreben über die Jahre hinweg einfach eine hohe Konsistenz attestieren. Seit ich denken kann, steht sie für die gleichen Dinge ein: healthcare, Gleichberechtigung für Frauen, Schwarze, Hispanics gleichermassen, Versöhnung zwischen Israel und Palästina. Und dies in einer sich zwischen Kaltem Krieg und heute rasant verändernden Welt. Vielleicht ist grace ein durch eine subjektive Wahrnehmung bestimmter Begriff (wenngleich ich diese Einschätzung Bronfens teile). Vielleicht könnte man auch von ‚Haltung‘ sprechen.
Auf jeden Fall ist es interessant, wenn ein einzelnes Lachen eine solche Bedeutung erhält, das es jahrzehntelange Arbeit überstrahlt. Also das Lachen über Gadafis Tod steht als Ganzes für Clinton. Und obwohl wir wissen, dass sowohl 9/11 als auch die Golfkriege wie die Instabilisierung des Arabischen Raums unter die Bushs-Präsidentschaften fallen, wird Hilary Clinton über dieses eine (unsympathische) Lachen für die gesamte Misere verantwortlich gemacht.
Heute, an dem Morgen, an dem man die Aufgabe antreten muss, mit der amerikanischen Entscheidung zu leben, lese ich dieses Interview noch immer mit viel Wohlgefallen und Zustimmung. Doch diese Stelle lässt mich (weiterhin) stutzen. Kann denn wirklich die Lösung die Neuermächtigung einer Élite (Bronfen sagt hier gar: „Klasse“) sein? Ich glaube es nicht. Wir müssen Bildung breiter denken, jenseits der Hierarchien und Autoritäten. Denn auch die Foren denken jenseits dieser Kategorien. Nur wenn die Bildungsstruktur zeitgemäß ist (und das ist das Denken einer sendenden Bildungselite eben nicht mehr), kann man noch hoffen, dass sich die Dummheit wenigstens mäßigt. Eine die Masse belehrende Expertenelite wird in Zeiten von Facebook niemals Gehör finden. Zumindest, solange sie sich selbstgefällig als solche inszeniert. Aber das ist natürlich auch nur meine Meinung – im Strom der vielen anderen.
das scheint mir richtig. Nur wie? Wie kann eine ‚Dummheit‘ mässigende Bildungsstruktur aussehen, die echt ernsthaft dem besseren Argument / den Fakten Gehör verleiht? Foren, Facebook-Blasen sind ja durchaus ebenfalls exkludierend…
Wenn ich das wüsste, liebe Corinna. Momentan weiß ich es nur unkonkret auszudrücken: weniger Wille zum Elitarismus, mehr Wille zur Diskussion auf Augenhöhe (auch wenn man dazu nach der eigenen Selbstbild-Blaupause mal in die Hocke gehen muss). Eine Zeitschrift, die Artikel von durchaus zum Elitarismus neigenden Autoren mit einer vollwertigen, beim Druck nicht exkludierten Kommentarfunktion umgibt, scheint mir zum Beispiel für dieses Vorhaben schon mal in die richtige Richtung zu gehen.
Vom eigenen Selbstentwurf abrücken, welcher auch immer es sein mag, und anderen Meinungen respektvoll Gehör und Gedanken schenken, scheint mir ein guter Weg zu sein.
Danke sehr, Matthias Däumer! Ich bin genau über denselben unverdaulichen Satz gestolpert in diesem spannenden Interview.
“This whole idea that he was an outsider and going to destroy the political establishment and drain the swamp were the lines of a con man, and guess what — he is being exposed as just that,”
http://www.nytimes.com/2016/11/12/us/politics/trump–campaigned–against–lobbyists–now–theyre–on–his–transition–team.html?smid=fb–nytimes&smtyp=cur
Wann lernt Ihr „Experten“ mit der Realität, hier der Wahl Eures Verhassten, umzugehen, statt immer nur Eure Meinung als „wahr“ zu betrachten. Amerika hat den Präsidenten gewählt, den das Land will. Dies ist ohne wenn und aber zu akzeptieren. Was würdet Ihr „Experten“ sagen, wenn sich Clinton in unsere Wahlen einmischen und diese als undemokratisch bezeichnen würde?
Es braucht Führungskräfte, davon haben wir leider in der schweizerischen Politik zu wenig. Wir werden sehen, was Trump aus Amerika macht. Sein Spielraum ist nicht so gross wie von Vielen befürchtet. Für mich ist er sicher weniger käuflich als die Clintons. Von der Vergangheit des Ex-Präsidenten und seinem „vorbildlichen“ Benehmen war nie die Rede. Dass Trump aber einer schönen Frau etwas unziemlich ein Kompliment macht, das sie herausforderte, das wurde ihm jedoch angelastet.
Wer nicht von sich selbst überzeugt ist, hat keinen Platz in irgend einer Führungsposition. Selbstzweifel helfen nicht kluge Entscheidungen zu treffen.
Sind Sie ein Troll, Herr Aesch?
Sehr geehrte® P.L.,
nein, ein Troll sind Sie gewiss nicht. Sie vertreten eine Meinung, mit der Sie auch nicht alleine sind und die doch einfach eine Meinung unter anderen ist.
Nun wurde das Interview mit Elisabeth Bronfen vor der Wahl geführt, nämlich schon Anfang Oktober. Es ging also nicht darum, die Legitimität der Wahl zu bezweifeln, weil die Wahl noch gar nicht stattgefunden hatte. Vielmehr wurden die Hintergründe für die kollektive Begeisterung für Trump erörtert. Deshalb bleibt das Interview auch nach der Wahl aktuell.
Denn was tun Experten? Sie beobachten, fragen und unterfüttern Meinung mit Wissen. Sie beobachten z.B. den von Ihnen angesprochene Umgang mit der Vergangenheit einer Person. Dabei stellen sie fest, dass eine Vielzahl von Wählern die beiden Kandidaten mit unterschiedlichen Massstäben bemass. Z.B. Clinton scheint auch Ihnen käuflich. Trump weniger. Clintons Vergangenheit ist wichtig, Trumps nicht.
Wissenschaftlerinnen fragen nun: Warum? Liegen diesen Urteilen eine Vermutung zugrunde oder harte Fakten? Und dann fragen Wissenschaftler: Woher kommen die Informationen, welche Interessen verbinden sich mit ihnen? Und schliesslich fragen sie: Wie sind diese Informationen rhetorisch gemacht? Welche Geschichten und Mythen werden genutzt, um die Nachricht zu transportieren?
Und dann zeigen sie, wie sich ein Präsidentschaftskandidat auf eine alte, bereits vorhandene Erzählung setzt, sich von ihr nährt und von ihr nach oben getragen wird. Die Erzählung Trumps ist die des einsamen, starken, weissen Mannes, der in einem korrupten System den Ausnahmezustand beherrscht; eine Gründer-Wild-West-John-Wayne-Cowboy-Geschichte mit nostalgischen Anleihen in den 50er Jahren.
Also was leistet die Literaturwissenschaftlerin hier? Sie fragt, beobachtet, ist neugierig und klärt im Rahmen ihres Fachgebietes auf über die Macht von alten Erzählungen.
Es tut gut, dieses Interview zu lesen. Hier in New York, wo ich gerade lebe, habe ich bisher eine solche Analyse, die die gegenwärtigen Ereignisse mit einer langen kulturellen Tradition in Verbindung bringt, nicht gefunden. (Frau Bronfen macht es mir einfacher, die Figur Trump und die kulturellen Gründe für deren Erfolg zu verstehen. Ein Verständnis, was in den linksliberalen Zeitungen wie der NYTimes meinem Eindruck nach gar nicht erst versucht wird.)
Für mich birgt die Darstellung von Trump als amerikanischer Typus des Hochstaplers allerdings auch Gefahren: es klingt so, als wäre Trump eben ganz und gar ein amerikanisches Phänomen, basierend auf dem seit Jahrhunderten gewachsenen amerikanischen Kultur des con man, der Risikofreude etc. Hier in den New York wird Trump hingegen viel häufiger als Teil einer politischen Strömung dargestellt, wie sie seit zirka 10 Jahren viele „westliche“ Länder mehr und mehr erfasst: der Aufstieg eines neuen Rechtspopulismus – nur eben ein besonders verheerendes Beispiel. Trump ist, um seine eigenen Worte zu gebrauchen, „Brexit plus plus plus“ oder eine unterhaltsamere Variante der Alternative für Deutschland.
Ich stelle mir die Frage, ob man nicht Gefahr läuft, die Entwicklungen in der westlichen Politik zu verharmlosen und zugleich antiamerikanische Klischees zu bedienen, in dem man Trump als (schmierige Version eines) amerikanischen Archetyp charakterisiert.