Ein Anwalt blase sich zu Beginn eines Prozesses mächtig auf, beeindrucke seine Klienten und schüchtere den Gegner ein. Danach müsse man sich, so ein befreundeter Jurist, durch viel Papier durcharbeiten. Jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, dem aufgeplusterten Anwalt die Luft rauszulassen.
Richard Schuberth ist zwar kein Anwalt, doch ein Luftrauslasser im besten österreichischen Sinne. Eben ist sein viel gelobtes Buch zu Karl Kraus, dem scharfen Kritiker und Satiriker der K&K‑Monarchie erschienen. Das Interview mit Richard Schubert haben wir im September via E‑Mail geführt.
Avenue: Lieber Richard Schuberth, wie halten Sie’s mit den Hochstaplern?
Richard Schuberth: In Literatur und Leben sind Hochstapler meine Lieblingsschurken, meine eigentlichen Helden. Den Räuber und Banditen als Sozialrebellen hatte ich relativ früh überwunden. Ich mag Täuscher, Blender, Gauner, falsche Priester, erfindungsreiche Plebejer, die sich höheren Status erschleichen. Ich hatte immer schon ein Faible für Travestie, Identitätswechsel, für Sinnestäuschung, Frivolität und Schwindel. Der gerade Michel ist nicht so mein Ding.
Zugegeben, unsympathisch sind auch mir der psychopathische Hochstapler, der naïve Menschen missbraucht, der falsche Herzchirurg mit französischem Akzent, oder der narzisstisch gestörte Hochstapler, der die bestehende Ordnung affirmiert, weil er sich selber durch eine höhere Position aufwertet. Trotzdem erfüllt er eine gesellschaftlich interessante Funktion. Der Hochstapler stellt die Ordnung der Gesellschaft auf den Kopf. Er überführt sie ihrer Heucheleien, foppt sie, zeigt Naivität und Verführbarkeit auf und spricht der Vorstellung von fixer Identität Hohn.
Avenue: Welche Hochstapler mögen Sie denn besonders gern?
Schuberth: Ich mag die Hochstaplerfiguren am liebsten, die gar nicht so auf Ego-Gewinn, sondern gleich auf materiellen aus sind. Sie genügen sich ohnehin selbst – und durchschauen en passant die Falschheit des gesamten Gefüges. Das 18. Jahrhundert ist die große Zeit der galanten und schlauen Halunken, das beginnt in den Travestien der Stuart-Komödien. Eine fantastische Hochstaplerin ist Daniel Defoes Moll Flanders. Rameaus Neffe von Diderot ist das wohl unmoralischste Hochstaplerstück, das je geschrieben wurde. Beide Texte zeigen eindringlich, dass ohne Hochstapelei nur materielle Not zu haben ist.
Bevor das Subjekt pathetisch, sentimental, romantisch und bierernst wurde, war das Vergnügen an Täuschungen und Wirrungen sehr groß. Aber man braucht gar nicht in die Fiktion gehen, die Geschichte beschert uns genug wunderbare Hochstapler. Und vergessen wir nicht die Hochstaplerinnen: Lola Montez etwa, Adah Isaacs Menken oder Mary Baker vulgo Prinzessin Carabu. Weibliche Hochstaplerinnen sind heroische Überwinderinnen ihrer gesellschaftlichen Machtlosigkeit. Ihr Risiko war stets grösser als das ihrer männlichen Kollegen. Man muss sich mal vorstellen, was für eine Selbstermächtigung es bedeutet, aus einer subalternen fixen und zugeschriebenen Identität auszusteigen. Ich mag Lügner, welche die Gesellschaft wahrlügen.
Im Grunde sind die meisten Menschen Hochstapler. In den Kulturwissenschaften, in Medien und Kunst erlebe ich fast nur Hochstapelei. Der Erfolg gibt ihnen Recht. Und Hochstapler evaluieren Hochstapler. Es gibt einen heimlichen Hochstaplerkonsens, der nur durch Menschen durchbrochen wird, die wirklich was können oder wirkliche Idealisten sind. Der bewusste Hochstapler aber führt den unbewussten oder halbbewussten Kollegen und Kolleginnen vor, dass sie auch nichts anderes sind als eben Hochstapler. Hochstaplerinnen und Hochstapler mit Absicht sind nolens volens Helden der Aufklärung.
Es gibt einen heimlichen Hochstaplerkonsens, der nur durch Menschen durchbrochen wird, die wirklich was können oder wirkliche Idealisten sind.
Avenue: Wie sieht es denn mit Hochstaplerinnen in ihren eigenen Texten aus?
Schuberth: Eine philosophische und feministische Hochstaplerin ist meine Romanfigur Biggy aus Chronik einer fröhlichen Verschwörung (2015). Und eine philosophische Hochstaplerin wird auch die Hauptfigur eines meiner nächsten Bücher sein, eine 400 Jahre alte Vampirin, die eine Teenagerin in den wahren Nonkoformismus einführt. Dieser Ratgeber wird heißen: How Not To Become A Zombie – A Vampyre Ladie’s Guide To Nonconformism.
Avenue: Sie haben soeben Karl Kraus. 30 und drei Anstiftungen (2016) veröffentlicht. Kraus hat seine Feder ja gegen allerhand Aufgeblasenheiten gespitzt.
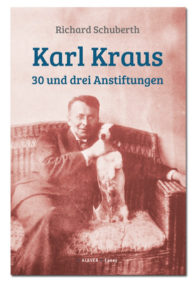
Schuberth: Karl Kraus hatte es in seiner Satire auf jegliches falsches Pathos, auf die falschen Bärte des Gravitätischen abgesehen. Alles was an der kakanischen Kultur aufgeplustert, gelackt, gespreizt und kapriziös war, hat er verspottet. Gerade in der Periode vor dem I. Weltkrieg trieb, vor allem in Literatur und Presse, dieses Streben nach dem Höheren, dem Wahren, der Vervollkommnung die bizarrsten Blüten und verstieg sich dann in Opferwille und Todessehnsucht. Sehr schön wird dieser Zeitgeist von Robert Musil im Mann ohne Eigenschaften bei seiner Beschreibung der „Parallelaktion“ eingefangen, mit der sowohl das österreichische als auch das deutsche Thronjubiläum vorbereitet werden sollte. In Deutschland kulminierte diese Witzlosigkeit zur Wagner’schen Oper, in Österreich reichte es nur zur Operette. Stets gerieten die großen Ideologien im provinzielleren Österreich zur unfreiwilligen und seltener freiwilligen Parodie.
Avenue: Wenn Sie die Schaumschlägerei in Kraus‘ (post-)kakanischen Österreich mit dem derzeitigen Österreich vergleichen – was stösst Ihnen heute auf?
Schuberth: Im heutigen Österreich herrscht eher das Pathos der Mediokrität vor. Man verbiedert und verbussit sich, und schließt aus. Mehr zu scheinen, als man ist, gehört zum Konsens des kulturellen und sozialen Umgangs. Menschen, die so viel scheinen, wie sie sind, gelten als höchst unsympathisch. Und weniger zu scheinen, als man ist, wirkt schlicht minderwertig. Leicht manipulierbar ist man aufgrund des Niedergangs des kritischen Denkens überall, aber es gibt selbst in der Verblödung Lokalismen. Die speziell österreichische Verblödung, bei der Antiintellektualismus und Vergötzung von charismatischen Führern stärker als sonst wo ist, sucht noch nach ihrem genialen Köpenick, der die Ösis ‚aufplattelt‘, wie man bei uns sagt.

Avenue: Wenn Hochstapelei recht weit verbreitet ist, wer wär‘ denn der Andere, vor dem es sich zu profilieren gilt? Gut verdienende Ausländer vielleicht? Vermengen sich in der kleinbürgerlichen Hochstapelei gar Abstiegsangst und Xenophobie?
Schuberth: Ihr engt mir den Fokus bisschen auf den Aufschneider ein, der mit Besitz und Status angibt, den er nicht hat. Das ist doch ein recht bescheidenes Personal in Anbetracht der prächtigen Möglichkeiten der Hochstapelei. Da gehören auch ein wenig die koksenden Rechtspopulisten dazu, wie sie in Österreich seit 30 Jahren immer wieder nachwachsen. Mir liegen mehr die smarten Trickbetrügerinnen der Screwballcomedies.
Österreich scheint das einzige Land zu sein, wo ein materialistischer Erklärungsansatz nicht greift, denn hier kann der Faschismus auch ohne Konjunkturschwäche Fuss fassen. Obwohl das alles, was ich sage, vermutlich auch für die Schweiz gültig ist.
Aber zurück zur eigentlichen Frage. Bei der spezifisch alpinen Vermengung von Angst vor sozialem Abstieg und Xenophobie kommen mir die Österreicher eher als Tiefstapler vor. Sie sind chronisch ängstlich, unsicher, ressentimentverseucht, duckmäuserisch und permanente Opfer. Nach wie vor ist Österreich eines der wohlhabendsten Länder der Welt. Das Sozialsystem ist trotz massiver Anfechtungen gerechter als in Deutschland, die Arbeitslosigkeit im europäischen Vergleich niedrig. Trotzdem war die Fremdenfeindlichkeit permanent hoch – auch in Zeiten der Hochkonjunktur. Der Faschismus hätte in Europa ohne die Depression nicht oder nicht so schnell gesiegt. Österreich hingegen scheint das einzige Land zu sein, wo ein materialistischer Erklärungsansatz nicht greift, denn hier kann der Faschismus auch ohne Konjunkturschwäche Fuss fassen. Obwohl das alles, was ich sage, vermutlich auch für die Schweiz gültig ist.
Avenue: Verstehen wir richtig: Hochstapelei und Sozialängste sind keine schichtenspezifisches Phänomene?
Schuberth: Im Neoliberalismus werden die Menschen wieder zu austauschbaren, überschüssigen Objekten degradiert. Sie geben diesen Druck auf klar definierte Feinde, die Anderen (Flüchtlinge) oder noch Schwächere (Obdachlose) weiter. In Österreich empfindet sich auch der Nichtprekarisierte als Würstel und muss folglich die Fremden nicht nur zu Würsteln machen, sondern fordert, dass ihnen die Haut abgezogen wird. Diese Mentalität spürt man erst, wenn man aus Ländern, wo man mehr Selbstbewusstsein, Zivilität und Herzlichkeit gespürt hat, nach Österreich zurückkommt. Sofort fällt einem auf, woran man zuvor zu sehr gewöhnt war. Die unruhigen, unsicher durchdringenden Blicke oder deren scheues Ausweichen, ein Air der latenten Aggression, ein permanenter Frust über reales oder eingebildetes Übervorteiltsein. Diese Pathologie verhindert einen klaren Blick darauf, wo man wirklich übervorteilt wird.

Avenue: Die 17-jährige Biggy, Heldin Ihres Buchs Chronik einer fröhlichen Verschwörung, erteilt einem alten Philosophen und damit auch uns Leserinnen eine Lektion. Sie rempelt in der U‑Bahn zehn Leute an. Anstatt dass sie sich beklagen, entschuldigen sie sich. Das ist sehr real …
Schuberth: … und sehr gefährlich. Italienisches theatralisches Aufplustern oder südosteuropäische machoide Großsprecherei sind berechenbar und harmloser als dieses mitteleuropäische Duckmäusertum. Aber ich darf nicht den Fehler machen, in die literarische Tradition des Antiösterreichertums zu verfallen, die ich ja sehr kritisiere, weil ich sie für einen umgedrehten Nationalismus halte, der dieses nationale Konstrukt ex negativo bestätigt. Die Österreichbeschimpfer haben für die österreichische Identität mehr getan als die konservativen Patrioten.
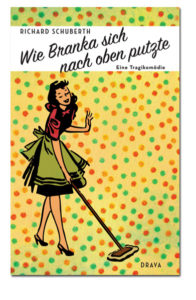
auf die sogenannten Ausländer-
und Genderdiskurse“
Bernd Vasari in der
Wiener Zeitung
Avenue: In Ihrem Theaterstück Wie Branka sich nach oben putzte (2012) führen Sie die junge Akademikerin Magistra Moser vor. Sie schwärmt für das ‚Unverstellte’ an ihrer Putzfrau Branka, die vom Balkan kommt. Sind Exotismus und Sozialkitsch ebenfalls eine Form von Hochstapelei im Sinne eines Gut- oder Wohlmeinens?
Schuberth: Nein. Ich finde, wenn wir diesen ohnehin vieldeutigen Begriff so weit fassen, verliert er sich in Bedeutungslosigkeit. Sozialkitsch und Exotismus sind bestenfalls naiv, Projektionen, die typisch sind für Bürgerkinder, die in Kategorien der persönlichen Identität denken und der Innenausstattung ihrer Erlebnis- oder Wohlfühlzonen viel Aufmerksamkeit schenken. Sie neigen zur Kulturalisierung. In ihrer Dichotomisierung von Eigenem und Fremden verfahren sie im Grunde genau so wie die Rechten, bloß, dass sie das imaginäre Fremde aufwerten. Das merkt man ja immer wieder bei vielen Linken. Im Antirassismus finden sie den kleinsten Nenner. Sie wollen die Opfer des Rassismus vor den Rassisten beschützen und bekunden dabei, dass gesellschaftlicher Kampf eine Frage von Haltungen sei. In dieser paternalistischen Vorstellung sind die Rassisten der pathologische Abschaum, sie selbst die aufgeklärten Bessermenschen und die Refugees ihre bemutterungswürdigen Schützlinge. Dass es die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern gilt, auf denen Rassismus und Irrationalismus wachsen wie Schimmel, wissen sie oft nicht mehr. Politische Ökonomie ist so trocken, partyuntauglich und so schrecklich Seventies.
Magistra Moser ist bloß in dem Sinne eine Hochstaplerin wie fast alle, die in akademischen Institutionen reüssieren. Sie schaffen sich die Codes und rhetorischen Minimalfähigkeiten an, welche Seriosität und Kompetenz markieren. Für geistige Vertiefung ihres Fachs bleibt in der akademischen Rat Race zumeist keine Zeit. Die Putzfrau Branka verkörpert für sie das pralle Leben. Alles wird verwertet, in diesem Fall nach dem Wellnessfilter. Wellness, schrieb ich im Buch Das neue Wörterbuch des Teufels (2014), ist das Behagen, das man uns geklaut hat und als Ware wieder andreht.
Avenue: Welchen Posten übernimmt die Putzfrau Branka in diesem Spiel zwischen Oben und Unten, Eigen und Fremd?
Schuberth: Branka verkörpert die rechte Urangst vor dem ausgefuchsten Ausländer, der uns ans Eingemachte will, das wir ihm bis jetzt erfolgreich vorenthalten konnten. Als sich das ‚linke‘ Bedürfnis Magistra Mosers nicht einlöst, vom bodenständigen Ausländer als mütterliche (oder schwesterliche) Komplizin geliebt zu werden, bröckelt auch ihre Gutmenschenschale ab. Nachdem die ‚Tschuschin‘, die ‚Romni‘, sich also nicht kulturalisieren lässt, bleibt nur das bildungsbürgerliche Überlegenheitsgefühl gegenüber dem Prolo übrig. Doch Branka ist auch das bizarr überzeichnete Symbol für die Benachteiligten, welche bei gleichen Rechten und Chancen tatsächlich in unsere Chefetagen eindringen und uns daraus verdrängen könnten. Magistra Moser scheitert, weil sie ihre eigene gesellschaftliche Position nicht wahrhaben will – sowie an dem Umstand, dass es da draußen wie in der Serengeti zugeht. Branka, der Knecht, ist eine vitalere und geschmeidigere Wahrnehmerin ihres Vorteils – und wer weiß, vielleicht auch eine begabtere Gender-Spezialistin als die Frau, für die sie putzt.
Avenue: Kann sich Branka denn überhaupt nach oben putzen?
Schuberth: Die grausame Pointe meines Stückes ist, dass Branka es mit Putzen eben nicht kann. Der US-amerikanische liberale Mythos vom Selfmademan (mit der Selfmadewoman funktioniert das umso weniger) wird durch den Neoliberalismus noch brutaler ad absurdum geführt: Der Leistungsdruck wird erhöht, das Hamsterrad dreht sich schneller, die Leistungsmonade, die Ich-AG sinkt sozial weiter ab, und nicht einmal das System braucht ihr das als persönliches Versagen oder Schmarotzertum vorwerfen, weil sie es schon selber tut.

Avenue: Also führt Branka, die von unten kommt, nicht nur die Selbsttäuschung der Magistra vor, sondern auch den – falschen – Mythos von der Tellerwäscherkarriere.
Schuberth: Branka gelingt der Aufstieg nur durch List, durch Identitäts-Wechsel. Ich führe bloß die Herr-Knecht-Dialektik von Hegel mit feministischen Vorzeichen fort. Magistra Moser war ja hin- und hergerissen zwischen idealistischem Engagement (ihrer Rolle als Sozialwissenschaftlerin) und Anpassung und Hedonismus (ihre Rolle in der Privatwirtschaft). In ihrem Zwiespalt wittert Branka Heuchelei und Unsicherheit, und die will sie ausnützen. Über die Balkanophilie der Akademikerin schleicht sie sich in deren Leben, treibt sie in den Wahnsinn (nicht sie allein tut es, sie forciert den Prozess bloß) und nimmt peu à peu deren Identität an. Am Anfang sind es nur Wohnung und Kleider, ist es die materielle Seite des Aufstiegs, die Branka interessiert. Als sie sich aber auch um das bevorstehende Referat Magistra Mosers kümmern muss, wird sie – surprise – zur besseren Diskurskritikerin. Das ist die List der Vernunft in meinem Stück. Magistra Moser hat ihren intellektuellen Idealismus zugunsten ihrer Status- und Konsumwünsche verraten müssen und hat dadurch ihre tiefsitzende kleinbürgerliche Prägung entlarvt. Die böse Cinderella Branka bekommt am Schluss nicht nur deren Wohnung, sondern führt den kritischen Diskurs radikaler fort als ihre Vorgängerin. Doch böse Pointe, die Dialektik von Konformierung reißt nicht ab –, in der Schlussszene taucht eine neue Putze auf, und die kommt nicht aus dem ehemaligen Jugoslawien, dem plebejischen Süden oder aus der Türkei, sondern aus Ostdeutschland. One World, aber eine ganz und gar nicht harmonische.
Avenue: Wenn wir schon von Diskurs sprechen: In den Geistes- und Sozialwissenschaften gibt es eine präzise Wissenschaftssprache. Schmal ist allerdings die Grenze zu einer ärgerlich komplizierten, letztlich unverständlichen Schutzsprache. In Branka putzt sich nach oben wird sie ‚Poststrukturalistisch’ genannt.
Schuberth: Zu diesen Punkten ließe sich eine ganze Avenue vollschreiben. Also werde ich versuchen, im Telegrammstil zu antworten.
- Imperativ von Karl Kraus dazu: „Ungewöhnliche Worte zu gebrauchen, ist eine literarische Unart. Man darf dem Publikum bloß gedankliche Schwierigkeiten in den Weg legen.“
- Meine Trennlinie verläuft nicht zwischen komplizierter und einfacher Sprache, sondern zwischen kluger komplizierter und unnötig komplizierter, zwischen guter einfacher und schlechter einfacher Sprache.
- Im Zeitalter der Blogs, SMS, schnell konsumierbaren und auf Konsens und Likes abzielenden Standpunktverortungen ist essayistisches Schreiben und Lesen, solches, das sich Zeit nimmt und den Gedanken durch seine Spiralen folgt, verpönt.
- Schnelle Eingängigkeit, Texte, die ‚einen abholen‘ sind angeblich gefragt. Doch wer ständig abgeholt wird, verlernt das Gehen, und die Widerstandskraft, sollte er/sie wirklich mal ‚abgeholt‘ werden.
- Hermetische Jargons sind genau so doof wie Sprachpopulismus, der sich dem jeweils aktuellen Sprachverluststand anbiedern will.
- Ansonsten bietet Dialekt wunderbare Möglichkeiten und Nuancen.
Wer ständig abgeholt wird, verlernt das Gehen.
Avenue: Nicht selten sprechen Schweizerinnen und Schweizer ostentativ Mundart, um sich nicht nur von den Deutschen, sondern auch den ‚Intellektuellen‘ abzusetzen. Allerdings ist, wer in der Schweiz Dialekt spricht, auch nicht ‚branded on the tongue‘.
Schuberth: Als ich nach Wien kam, gab es dort das typische Wienerisch, einen für vielen grässlichen gezogenen proletarischen Dialekt, der aber eine Fülle an poetischen und witzig mehrbödigen Wendungen kennt, und auch als Relikt alter Zeiten das näselnde ‚Schönbrunnerdeutsch‘ der Upper Class. Seitdem verschmelzen die zu einem mir unerträglichen Infantilsprech, den wir in den 90er Jahren schon ‚Scheißerldeutsch‘ nannten. Bereits zwei, wenn nicht drei Generationen reden so. Als trügen sie noch immer Zahnspangen und hießen sie alle Fluffy oder Schurli. Harmlos, regressiv, erfahrungslos, mittelständisch seicht, ohne Kanten und Ecken. Dieser Ton kratzt in den Ohren und ist chronisch unsexy. Ich nehme an, diese Wesen sind zur Endogamie verdammt, kein Artfremder, keine Artfremde kann sich mit ihnen paaren wollen.
„Duu, in der Josefschdädder Schdraaaaße haaad a neuer Koffi Shobb aufgmaaachd, du musst unbedingt amal die Gardamom-Basiligum-Mieschung ausbrobieeren. Du haasd gesdan den Grisemaan und Schdeermann im OAF gseehn? de waaarn wieeda ächd leiwand. Dodaal bolidigelli ingorregd. Hi hi …“
Das meine ich natürlich nicht so böse, wie ich es sage. Diese Wiener und Wienerinnen können sehr hübsch sein, aber sie sollten endlich lernen, dass die Sprachmelodie Wesen und Charakter verrät. Hochstapeln hieße ja auch neue Rollen ausprobieren, in die man so reinwächst, dass sie zur authentischen Persönlichkeit werden. Somit ginge Lernen nicht ohne Hochstapelei. Seht ihr, jetzt ist mir unabsichtlich auch noch ein Schlussgedanke zu eurem Thema eingefallen.
Hochdeutsch mit einem leicht melancholischen österreichischen Touch ist übrigens das schönste Hochdeutsch, das ich kenne. Oskar Werner konnte das, und hat es auch ein wenig übertrieben.

Richard Schuberth ist Schriftsteller, Gesellschaftskritiker, Satiriker, Cartoonist und gelegentlich Schauspieler und Regisseur. Neben seinem künstlerischen Schaffen arbeitete Schuberth auch als Musikjournalist (sein erstes Buch war ein 500-seitiges Musiklexikon), als Texter, Sperrmüllsammler, Medikamentenproband, als Gestalter von Radiosendungen sowie als Gründer und Leiter eines Balkan-Musikfestivals („Balkan Fever“). Für sein künstlerisches und politisches Engagement wurde ihm der MigAward (als “Persönlichkeit des Jahres”) verliehen, eine Auszeichnung, die ausschließlich von Migranten und Menschen mit Migrationshintergrund per Voting vergeben wird. Mehr über Richard Schuberth in der Wikipedia oder auf seiner Website.
Erwähnte Literatur
Schuberth, Richard. 2016. Karl Kraus. 30 und drei Anstiftungen. Wien: Klever Verlag
Schuberth, Richard. 2015. Chronik einer fröhlichen Verschwörung. Wien: Zsolnay
Schuberth, Richard. 2014. Das neue Wörterbuch des Teufels. Ein aphoristisches Lexikon. Wien: Klever Verlag
Schuberth, Richard. 2012. Wie Branka sich nach oben putzte. Eine Tragikomödie in drei Akten. Klagenfurt: Drava
Bildnachweis
„Alhambra“, fotographiert von Corinne Rusch.
Herausgeber*innen
Anmerkung: Die Herausgeber*innen der Avenue lancierten zu Weihnachten 2020 die Initiative Salz + Kunst als Antwort auf die Einschränkung des künstlerischen Lebens während der Corona-Pandemie. Im Sinne von art on demand vermittelt die Plattform Kunststücke nahezu aller Kunstsparten in den privaten Raum: ein Jodel im Vorgarten, ein philosophisches Gespräch per Zoom, ein Gedicht per Whatsapp, ein Violinkonzert auf dem Balkon …







Warum im „Neoliberalismus“? Also über den „Neoliberalismus“ entsteht die Parallele zu Kraus‘ (post)k&k Österreich? Und dazwischen war’s irgendwie anders?