Woran erkennt man, dass man wirklich etwas Neues anfängt? Dass man sich wie ein Hochstapler vorkommt. Das Jahr war 1990, glaube ich. Ich war ein schüchterner Doktorand und hatte mich beworben, an einer Tagung über Riten und Rituale im Mittelalter teilzunehmen, als Zuhörer. Es sprachen berühmte Spezialisten aus Paris, Florenz und New York, und genauso aufregend und exotisch war der Ort: Erice auf Sizilien, eine mittelalterliche Stadt auf einem Berggipfel hoch über dem Meer. Getagt wurde in einem luxuriös renovierten Kloster aus dem 13. Jahrhundert, das dem Veranstalter gehörte, einer etwas geheimnisvollen Stiftung für den Frieden.

Die Stiftung bezahle auch alles, wurde uns am ersten Abend mitgeteilt, nicht nur den berühmten Professoren, sondern auch den Doktoranden: Kostenloses Abendessen in allen Restaurants der Stadt, wenn wir nur unseren Teilnehmerausweis vorzeigten. Ich hatte vorher nie genügend Geld gehabt für so etwas im Urlaub. Weisse Tischtücher, polierte Weingläser, und das Essen war fabelhaft. „Weißt Du, wie ich mir vorkomme?“ flüsterte der nette israelische Kollege, der neben mir sass. „Wie ein Hochstapler. Ich denke dauernd, gleich legt mir jemand die Hand auf die Schulter und sagt: Sie kommen jetzt besser unauffällig mit. Es ist alles herausgekommen.“
Gefälschte Zeichen

Die Figur des Hochstaplers passt gut zu Riten und Ritualen, und zum Mittelalter sowieso, denn da tauchten die ersten Berichte von erfolgreichen Hochstaplern auf. 1225 gab sich in Flandern ein Spielmann und Gaukler mit grossem Erfolg als König Balduin IV. von Jerusalem aus, wunderbarerweise wieder auferstanden und von der Lepra geheilt; ähnlich der Mann mit dem schönen Namen Dietrich Holzschuh, der 60 Jahre später als wiedergekehrter Kaiser Friedrich II. von Hohenstaufen auftrat.
Dass das jeweilige Original zu diesem Zeitpunkt schon über 30 Jahre tot war, hat die zahlreichen Anhänger beider Wiedergänger weiter nicht gestört: Schliesslich konnten sie signa verisimila vorzeigen, wahre Zeichen, dass sie tatsächlich der wunderbar von den Toten auferstandene Herrscher seien – vermutlich Herrscherinsignien oder Körperzeichen wie Narben.
In einer Welt ohne Zentralverwaltung, in der sich jeder in einer neuen Stadt eine neuen Namen und – genügend Bargeld vorausgesetzt – eine neuen Stand zulegen konnte, müssen derartige Fälle ziemlich häufig gewesen sein. Um Betrug vorzubeugen, wurden deshalb im 15. und 16. Jahrhundert die ersten Ausweise obligatorisch: Zuerst für Diplomaten, dann für Soldaten, Bettler und Pilger ausgestellt, wurden solche offiziell besiegelte Dokumente dann rasch allen Reisenden zu Pflicht gemacht – wenigstens auf dem Papier.
Gefälschte Papiere
Am Beginn der Neuzeit begann der Staat, möglichst viel über seine Untertanen aufzuschreiben und sie mit Hilfe von Siegeln, Formularen und Papier – sehr viel Papier! – zu erfassen und zu kontrollieren. Man kann es auch anders sagen. In denselben Jahrzehnten, in denen die ersten Autobiografien in der ersten Person Singular geschrieben und die ältesten Selbstporträts gemalt wurden, die viel zitierte (und noch häufiger verkitschte) „Entdeckung des Ich“ im Europa der Renaissance, ging es nicht nur um Erforschung, sondern auch um Erfindung des eigenen Selbst. Und zwar mit Hilfe von Papier.
Im Europa der Renaissance ging es nicht nur um Erforschung, sondern auch um Erfindung des eigenen Selbst. Und zwar mit Hilfe von Papier.
Im 16. Jahrhundert wurde in Europa jene Verwaltungsutopie formuliert, die von nun an Individualität und Identifikation bestimmen sollte: „Alles Aufschreiben“. Das Konzil von Trient hatte 1563 das Decretum Tametsi verabschiedet, das allen Pfarreien Tauf- und Heiratsregister vorschrieb: Damit sollten damit heimliche Namenswechsel, Bigamie und Doppelleben verhindert werden. Der französische Jurist Jean Bodin schlug 1576 sogar vor, alle Untertanen von Amts wegen mit Namen, Stand und Wohnort zu erfassen, um Betrüger, Bettler und Müssiggänger endlich zu identifizieren, die „sich unter den Anständigen aufführen wie Wölfe unter Schafen“ (Bodin 1583/1986, S. 311)
In dieser neuen Welt, in der die Staaten beschlossen hatten, an ihre eigenen bürokratische Bescheinigungen auf Papier zu glauben, entstanden eben auch für die Wölfe wundervolle neue Möglichkeiten: Das goldene Zeitalter der Hochstapler brach an. Denn wie ihre Zwillingsbrüder, die Spione, hatten die immer eindrucksvolle Papiere. Das Echte an all den neuen obrigkeitlichen Personaldokumenten war Produkt von Vervielfältigungstechniken im Wortsinn: Stempel, Siegel und gedruckte Formulare. Diese reproduzierten Zeichen der Echtheit wurden aber im Zeitalter der Vervielfältigung, das mit Holzschnitt und Buchdruck angebrochen war, von technisch begabten Individuen selbst wieder reproduziert.
Das goldene Zeitalter der Hochstapelei

Eindrucksvolle Empfehlungsschreiben und Dokumente konnte deshalb schon jener David Reuveni vorzeigen, der 1524 zuerst in Venedig, dann in Lissabon und schliesslich in Mantua auftrat: Er sei der Bruder eines mächtigen jüdischen Königs, gab er an, Herrscher über ein sagenhaftes Reich namens „Habor“ weit im Osten, und sei bereit, mit 300,000 Mann sofort das Osmanische Reich anzugreifen und Jerusalem zu befreien. Alles, was er dafür brauche, sei ein wenig Geld, um neue Kanonen zu kaufen.
Originaldokumente konnte auch der Mann präsentieren, der 1555 als König Edward VI. von England von sich reden machte: Er sei nicht gestorben, sondern nur schwer erkrankt und jetzt eben wunderbarerweise wieder geheilt. In den 1580er und 1590er Jahren erschienen gleich mehrere Wiedergänger des 1578 auf dem Schlachtfeld gefallenen Sebastian von Portugal. 1605/06 ergriff in Russland jener Demetrios die Macht, der behauptete, der 1591 von Boris Godunov ermordete Zarewitsch zu sein.
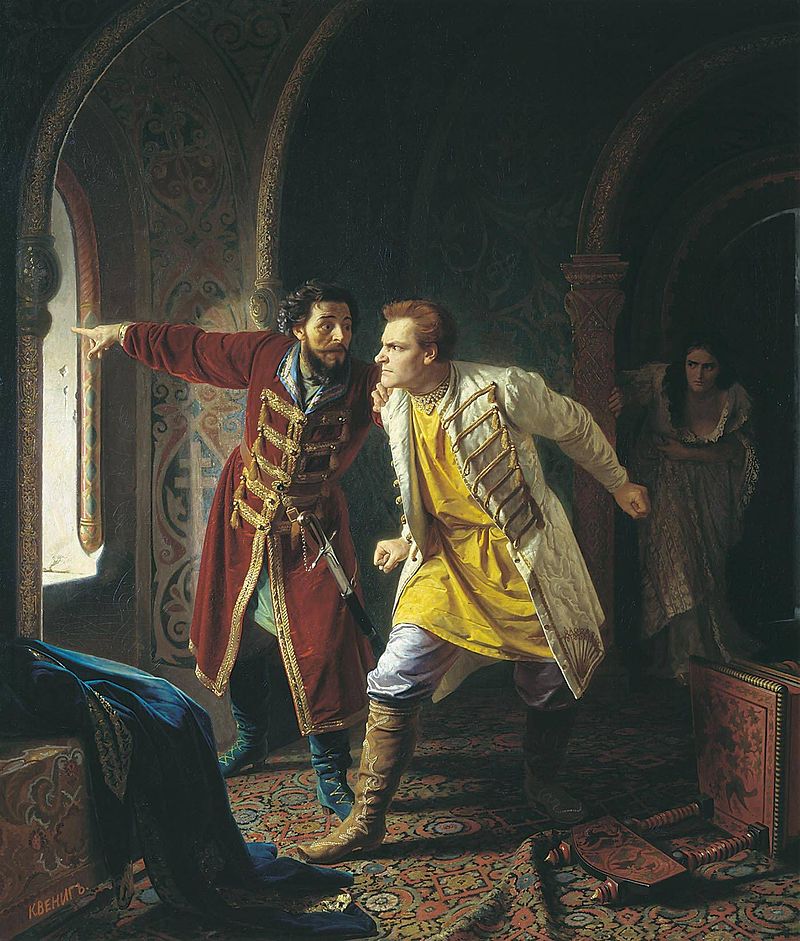
Wechselvoller verlief die Karriere von Jean Allard: In Frankreich geboren, stieg er in den 1570er Jahren in Schweden zum Gärtner am Königshof und wurde schliesslich mit dem Amt des schwedischen Botschafters in Venedig betraut. Mit Bescheinigungen über große Summen, die hochgestellte Personen ihm angeblich schuldeten, und Papieren über den angeblichen Verkauf schwedischer Schiffe und Artillerie konnte Allard in Venedig und Mailand umfangreiche Kredite aufnehmen. Der Mann muss charmant gewesen sein: Von der Inquisition wegen kritischer Bemerkungen über den Heiligen Stuhl inhaftiert, schaffte er es in Rom, nicht nur freigelassen zu werden, sondern zum persönlichen Protegé des Papsts aufzusteigen.
Nach einer unter skandalösen Umständen gescheiterten Verlobung mit einer reichen Erbin musste Allard dann allerdings rasch weiter. Er schaffte es, mit Bescheinigungen über Geldsummen, die ihm angeblich von Heiligen Stuhl zustünden, am Hof des protestantischen Herzogs Heinrichs von Navarra in Südfrankreich zu einer einflussreichen Figur zu werden. Als ihn dort Nachrichten über seine schwedische Vergangenheit einholten, wechselte er 1582 zu den katholischen Erzfeinden des Herzogs, an den Pariser Hof von König Heinrich III. Von dort ging Allard in die Schweiz. In Genf und Basel gab er sich als französischer Diplomat aus und nahm unter Berufung auf seine Verbindungen in höchste politische Kreise weitere Kredite auf: Luzern verlieh diesem wichtigen Mann sogar das Bürgerrecht. Anstelle die dafür versprochenen 20 000 Goldstücke zu bezahlen, verließ Allard die Stadt über Nacht, sicherte sich in Bern unter Vorzeigung eindrucksvoller Empfehlungsschreiben und Schuldscheine erneut Vorschüsse und wurde auf Betreiben echter französischer Diplomaten in Neuchâtel festgenommen. Beim Versuch, dort aus dem Fenster seines Gefängnisses zu klettern, glitt er aus und stürzte tödlich ab.
Das maskierte Ich
Ein direkter Zeitgenosse von Allard, der Diplomat und Philosoph Michel de Montaigne, hat in denselben Jahren in seinen Essais die gründliche Selbsterkundung zum Programm erhoben: „Ich selber, Leser,“ so seine Vorrede, „bin also der Gegenstand dieses Buches.“ Und bemerkte weiter hinten trocken: „Die Verstellung ist eines der auffälligsten Kennzeichen unseres Jahrhunderts.“ Das erscheint als Fazit in jenem Abschnitt, der vom Reden über sich selbst handelte.
War also in jedes Reden über sich selbst Betrug und Hochstapelei immer schon eingeschrieben? Im Zeitalter erbitterter blutiger Kämpfe um religiösen Wahrheitsanspruch, richtige Seelenerforschung und Selbstauskunft war das beunruhigender Stoff. Unter Montaignes gelehrten Kollegen kursierten Gerüchte über ein Buch, das Von den drei Hochstaplern (lat. De tribus impostoribus) heisse und Moses, Jesus Christus und Mohammed als die grössten aller Betrüger entlarve. Politische Gegner warfen einander gegenseitig vor, diese teuflische Schrift zu besitzen und zu verbreiten; so unterschiedliche Autoren wie Boccaccio, Aretino, Rabelais, Giordano Bruno und Tommaso Campanella wurden als Verfasser verdächtigt. Existiert hat das Buch wirklich. Verfasst worden ist es aber erst nachträglich, um 1680, nachdem Verstellung und Simulation über mehr als hundert Jahre zum beliebten Themen für Debatten unter Gelehrten geworden waren.
Manipulation, Täuschung und Verstellung sind in jede solche Selbstdarstellung immer buchstäblich mit eingeschrieben.
Einer der berühmtesten Naturforscher und Philosophen der Frühen Neuzeit, René Descartes, führte selbstbewusst das lateinische Motto Larvatus prodeo – „Maskiert komme ich voran“. Anweisungen wie das Handorakel des Jesuiten Baltasar Graciàn von 1647 lehrten, wie man mehrdeutig rede, sich geänderten Situation am besten anpasse und am geschicktesten simuliere (vgl. dazu Groebner 2004).

Wenn jeder ununterbrochen Auskunft geben muss, wer er ist, wo er herkommt, woran er wirklich glaubt, und wenn grosse Apparate von Inquisitoren, Kontrolleuren und Inspektoren, geschaffen werden, um herauszufinden, ob das auch wirklich stimmt, dann ist das Reden über Wahrheit von Politik und Macht eben nicht zu trennen – Montaigne, Descartes, Graciàn und ihre Kollegen waren ja nicht weniger kompliziert als wir. Und getraut haben sich die Leute im 16. und 17. Jahrhunderten auch mindestens so viel wie heute, wie die Hochstaplerkarrieren von Allard und anderen zeigen. Das eigene „Ich“ dokumentieren und herzeigen ist nie nicht nur Privatsache. Manipulation, Täuschung und Verstellung sind in jede solche Selbstdarstellung immer buchstäblich mit eingeschrieben. Aber kommt einem das im Zeitalter des gehackten Portals MySpace, von „Don’t Be Evil“-Google und „Nur Klarnamen!“-Facebook nicht irgendwie bekannt vor?
Hochgestapelte Kontrolle
Der Aufstieg des Hochstaplers in Europa vor fünf Jahrhunderten vollzog sich gleichzeitig mit unablässigen Bemühungen um immer zuverlässigere Systeme von Beschreibung, Erfassung und Kontrolle. Alle diese Systeme mussten notwendigerweise selbst Aspekte der Fiktion enthalten (oder, wenn uns das besser gefällt, der administrativen Abstraktion), wenn sie lebendige und wirklich existierende Personen durch Aufschreiben und Registrieren festhalten und sozusagen vervielfältigen wollten. Institutionen setzen sich nicht deshalb durch, weil sie sich der ihnen umgebenden Wirklichkeit möglichst effizient anpassen. Im Gegenteil, Institutionen werden deshalb zu solchen, weil sie selbst über ihre Wirksamkeit hochstapeln; weil sie ihre eigenen Kriterien der Wirklichkeit überziehen und sie dadurch verändern.

So erzählt das jedenfalls einer, der es wissen muss. Gert Postel, geboren 1958, ehemaliger Postbote, hatte sich am Beginn der 1980er Jahre mit gefälschten Urkunden mehrfach als Notarzt und psychiatrischer Facharzt ausgegeben, bevor er als Dr. med. phil. Clemens Bartholdy in Norddeutschland als Amtsarzt eingestellt wurde. Er hatte sich schon erfolgreich auf einen neuen Job an einer Universitätsklinik beworben, als ihm 1984 verlorene Ausweise, ausgestellt auf unterschiedliche Namen, zum Verhängnis wurden. (Die Erfindungen des 15. Jahrhunderts haben eben lange Nachwirkungen.) 1995 wurde er erneut als Oberarzt in einem psychiatrischen Fachkrankenhaus angestellt – diesmal unter seinem richtigen Namen, plus eindrucksvollem gefälschtem akademischem Lebenslauf. Er praktizierte mehr als zwei Jahre. Die Beförderung zum Chefarzt hatte er schon in der Tasche, als alles herauskam. 1999 wurde er wegen Urkundenfälschung, Betrug und Missbrauchs von akademischen Titeln zu vier Jahren Haft verurteilt und wegen guter Führung nach zwei Jahren entlassen. Ein sympathischer Mensch; mit vielen erfolgreichen Fernsehauftritten. Autor eines Bestsellers ist er mittlerweile auch: Doktorspiele (Postel 2001) heisst das Buch, in dem er sich als Hochstapler unter anderen Hochstaplern beschreibt, seinen Doktorkollegen mit echten Titeln. Und es gibt eine Gert-Postel-Gesellschaft, die verlangt, das ihm der Nobelpreis verliehen wird.
Unterwürfige Hochstapelei in der (Geistes-)Wissenschaft
Hätte mich das beruhigt, als ich mir auf meiner ersten Konferenz auf Sizilien wie ein Hochstapler vorkam? Die wunderbar dotierten Konferenzen in Erice gab es noch ein paar Jahre. Dann kam der grosse Korruptionsskandal der Tangentopoli, gefolgt von der der Operation mani pulite, saubere Hände, der grosse Teile der etablierten italienischen Politiker für immer von der Macht verbannte. Einige wanderten kurzzeitig sogar ins Gefängnis, auch auf Sizilien. Die diskrete Stiftung gibt es noch, soweit ich weiss. (Ihre Homepage ist nicht so richtig auskunftsfreudig.) Aber die grosszügig finanzierten Konferenzen für Historiker hörten Mitte der 1990er Jahre abrupt auf.
Und über diese betrügerische Welt der Geisteswissenschaften wolle er jetzt einen zweiten Roman schreiben.
Ein Hochstapler ist ein Hochstapler, weil er es immer wieder versucht. Er könne sich durchaus vorstellen, hat Postel in einem Interview (Müller 2016) gesagt, glaubwürdig als Jurist aufzutreten, am liebsten als Richter an einem Landgericht – aber nur im Strafrecht, sagt er, beim Zivilrecht gehe es nur mit echten Kenntnissen. Über die akademische Welt der Geisteswissenschaften dagegen urteilt er hart. Er sei längere Zeit mit einer Professorin für Geschichte verheiratet gewesen, vertraute er seinem Interviewer an. Dort herrschten unglaubliche Arroganz und Hochmut. Und über diese betrügerische Welt der Geisteswissenschaften wolle er jetzt einen zweiten Roman schreiben.
Postels Interviewer, ein promovierter Historiker, hat ihm übrigens abgeraten. Obwohl es mehr Historiker als Psychiater gäbe, interessierten sich nur wenige Leute für deren Arbeit, sagte er; und vor Historikern – im Gegensatz zu Psychiatern – fürchte sich auch niemand. Oder ist auch das ein raffiniertes Manöver? Auffällig ist zumindest, dass alle Professoren für Geschichte, die ich kenne, in der Rückschau behaupten, sie hätten nie Professor werden wollen: Es habe sich einfach so ergeben.
Bei mir ist das auch so. Denn das wussten schon die Gelehrten vor vier Jahrhunderten: Nie zu dick auftragen, wenn es um einen selber geht. Viel besser, sich auf den Zufall zu berufen, auf das eigene Glück: Man sei eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Und das stimmt natürlich auch. Denn erzeugt wird ein Wissenschaftler von den Institutionen, die ihn beschäftigen. Die verkünden, dass sie Wahrheit, echte Wahrheit, nichts als die Wahrheit produzieren, verwalten und bescheinigen – mit schönen Dokumenten, gesiegelt und gestempelt im Namen des Staates. Ganz wie vor vierhundert Jahren.
Bescheinigung und Täuschung, Selbsterforschung und Maskenspiel, demonstrative Bescheidenheit und Hochstapelei gehören eben zusammen
Bescheinigung und Täuschung, Selbsterforschung und Maskenspiel, demonstrative Bescheidenheit und Hochstapelei gehören eben zusammen – aus der Sicht der Wissenschaftsgeschichte auf jeden Fall. Und niemand weiss das besser als wir Gelehrten. Deswegen sind wir auch ein bisschen barocke Höflinge. Das würde jedenfalls ein paar Eigenheiten des Wissenschaftsbetriebs ganz gut erklären: die Neigung zu Ritualen, Hofzeremoniellen und prunkenden Titeln. Die schmeichlerische Unterwürfigkeit gegenüber Sponsoren. Und die schlechte Nachrede über Kollegen.
Literatur
Bodin, Jean. 1583/1986. Sechs Bücher über den Staat. Buch IV-VI. Bd. 2. 2 Bde. München: C. H. Beck.
Groebner, Valentin. 2004. Der Schein der Person. Steckbrief, Ausweis und Kontrolle im Mittelalter. München: C. H. Beck. [auf Perlentaucher]
Postel, Gert. 2001. Doktorspiele. Geständnisse eines Hochstaplers. Frankfurt am Main: Eichborn Verlag.
Müller, Burkhard. 2016. „Postel. Die Einsamkeit des Hochstaplers“, in: Merkur. Zeitschrift für europäisches Denken. 801: 17–31.
Bildnachweis
“The snow has no voice”, fotographiert von Corinne Rusch.
uncode-placeholder
Valentin Groebner
Valentin Groebner ist Professor für Geschichte an der Universität Luzern. Von 1991 bis 1999 war er Assistent an der Universität Basel. Seither hat er gelernt, dass man nicht davor gefeit ist, von den eigenen Vätern unter anderem die Eigenschaften zu übernehmen, die man früher unerträglich gefunden hat.







Auch die Spätantike hat schon eine großartige Hochstaplergeschichte zu bieten. Lukian von Samosata berichtet vom Schwindel des Alexander von Abonuteichos, der im 2. Jahrhundert n. Chr. den Glycon-Kult in Kleinasien begründete. Sein Erscheinen als Prophet eines neuen Gottes war so gut vorbereitet und ging mit einem Wunder (der Geburt einer Schlange aus einem Ei) einher, dass die Menschen ihm einfach nur noch glauben konnten – auch wegen einer für die nötige Objektivität sorgenden Bronzetafel, die seine Ankunft ankündigte. Die hatte er zwar selbst verfasst, aber dafür gesorgt, dass die Menschen sie „zufällig“ fanden.
Schöne Geschichte, danke für den Hinweis! Lukian von Samosatas Texte kursierten ab dem Ende des 15. Jahrhundert in verschiedenen Übersetzungen unter den gelehrten Humanisten in ganz Europa. Inklusive der bösen Pointe, dass die Leute sich am liebsten für den Autoritäten fürchten, die sie selbst vorher erfunden haben.
Ein Hochstapler ist ganz wesentlich ein Hochstapler, weil er oder sie den Willen zur Macht hat. Das Fälschen der Dokumente oder anderer nötiger Beweise (wie z.B. Wunder) ist Instrument für den Erfolg des Schwindels, während das Ziel immer das Gleiche zu sein scheint – Macht. Das wird dann zum Problem, wenn wir den (fälschbaren) Dokumenten zu viel perlokutives Potenzial zusprechen. Weil sie dann nämlich zur Hochstapelei verführen.
Ist’s Betrug oder Hochstapelei? Auf jeden Fall beschäftigt sich die Literatur des ausgehenden 12. und 13. Jahrhunderts obsessiv mit der Übereinstimmung von Innen und Aussen. Da ist zum einen der Meier Helmbrecht – vgl. in dieser Ausgabe Matthias Däumer. Ein recht witziges Spiel mit Identität, Körper, Kleid und Zeichen treiben die deutschsprachigen Artusromanen. Hartmanns von Aue Figur Iwein beispielsweise wird vor lauter Liebeskummer so verrückt, dass sie sich selbst nicht mehr erkennt – geschweige denn jemand anderes. Schliesslich wird der schlafende Iwein als nackter Wilder von drei Damen entdeckt, die ihn anhand einer Narbe identifizieren, gründlich mit Zaubersalbe traktieren und so vom Wahnsinn heilen. Iwein selbst allerdings erfasst sich erst als Ritter wieder, als er frisch eingekleidet auf einem Pferd sitzt und sein outfit mit dem Aufdämmern einer Erinnerung kurzschliesst.
Ist nicht das Anrufen des Zufall die allerdreisteste Form von Hochstapelei? Denn wenn einem alles so elegant zufällt, dann ist das wohl das eigentliche Zeichen für Berufung. Man tut so, als ob man mit spielerischer Leichtigkeit alles erreicht – und arbeitet heimlich wie wild.
Stimmt. „Sprezzatura“ heisst das Prinzip, stammt aus dem Bestseller von Baldassare Castiglione von 1527, wie man bei Hof am besten Karriere macht. Nicht vorzeigen, dass man sich geplagt hat, Mühelosigkeit und Leichtigkeit simulieren – das wird honoriert. Deswegen können wir wohl einfach nicht herausfinden, ob Hochstapler faul sind. Vermutlich nicht fauler als diejenigen, die alle Ihre Titel auf legale Weise erworben haben, würde ich vermuten. Schliesslich ist auch Simulieren Arbeit – harte Arbeit.
[b][/b]