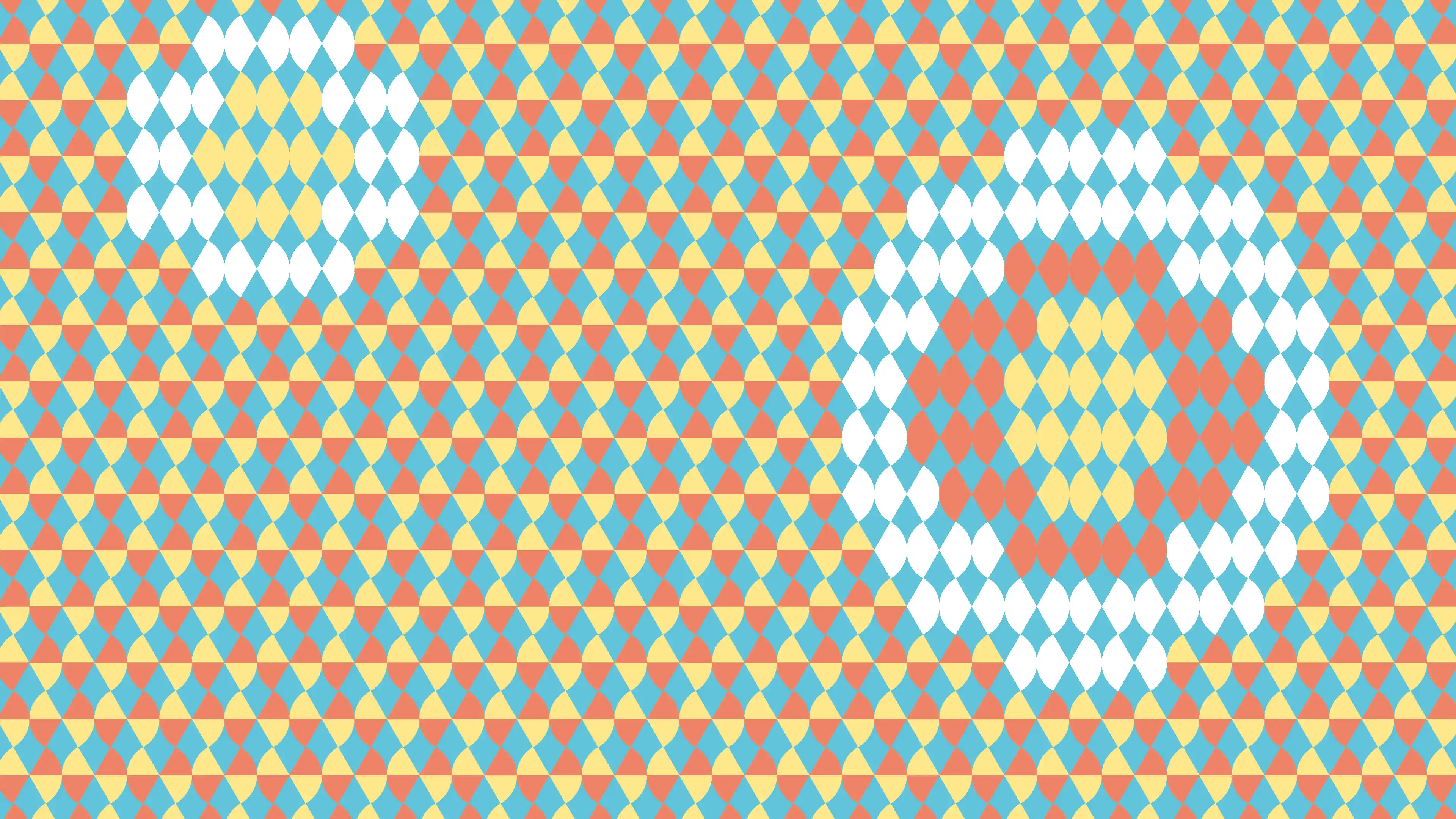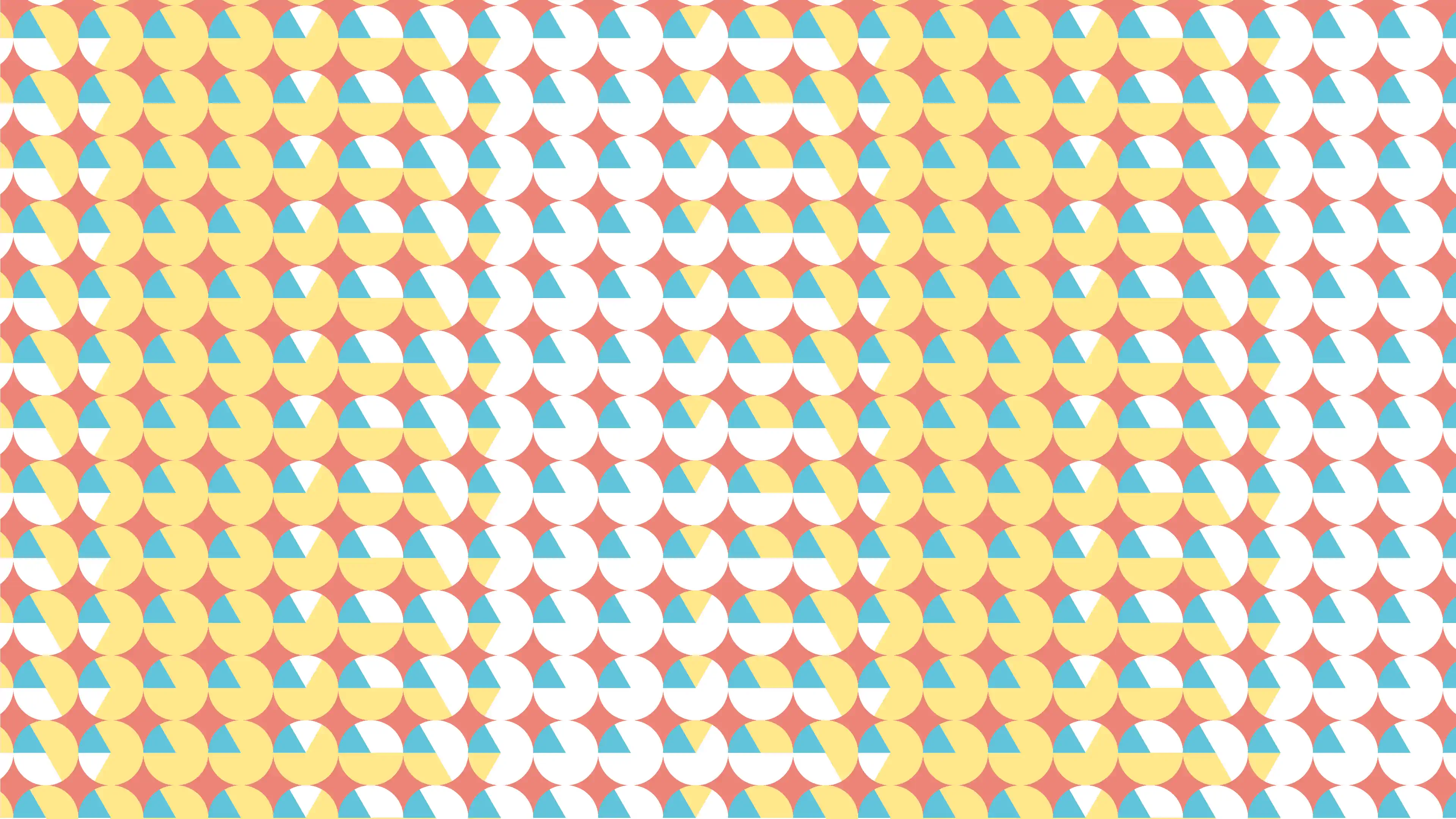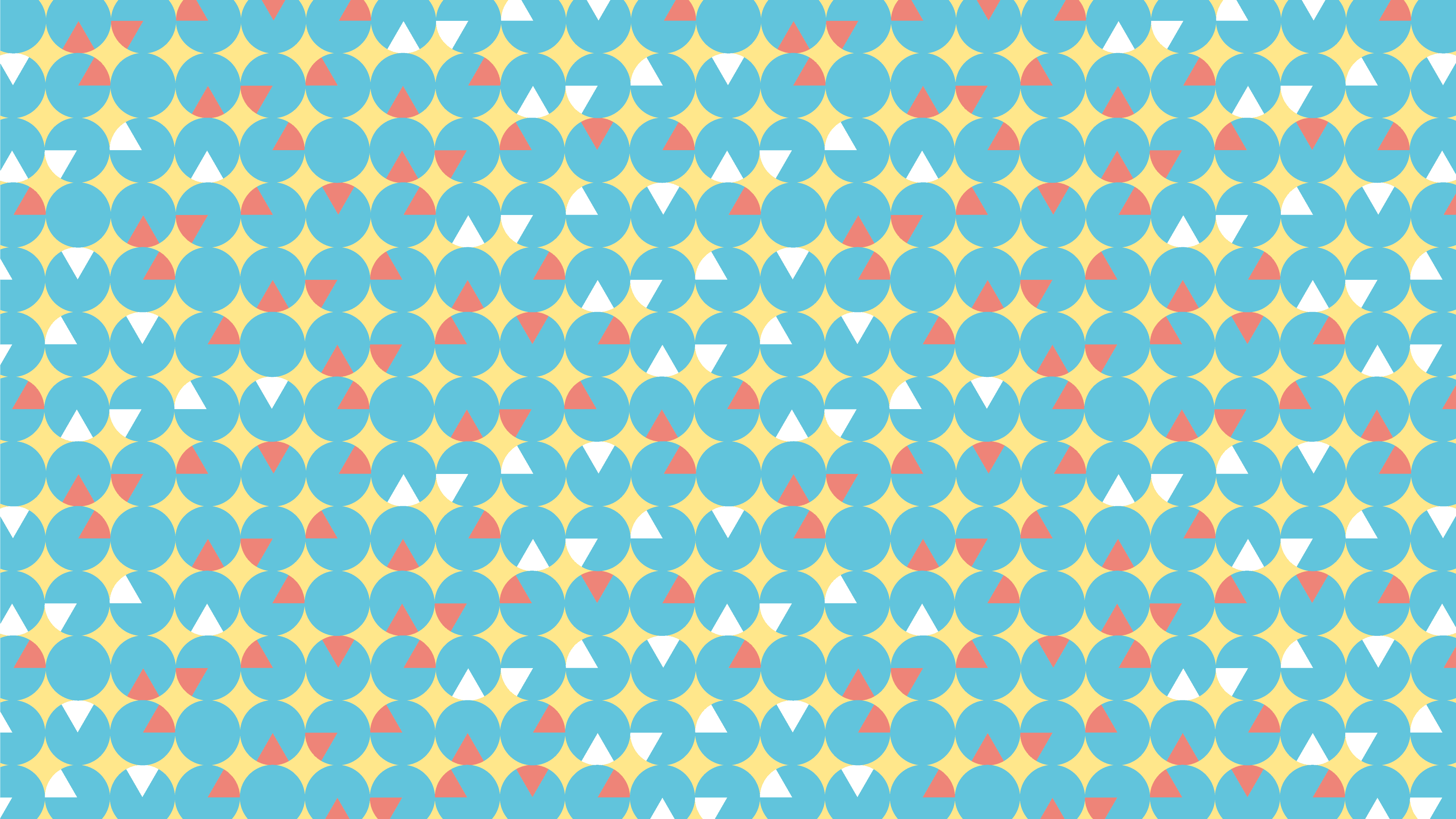Vademecum
- In Deutschland finden pro Jahr etwa 3 000 Schwangerschaftsabbrüche nach der 12. Schwangerschaftswoche statt.
- Der Spätabbruch ist weder gesellschaftlich noch kulturell thematisiert.
- Eine der wenigen Ausnahmen: der Film 24 Wochenvon Anne Zohra Berrached aus dem Jahr 2016.
Sexualität ist Zeitmanagement. Irgendwo zwischen Natur und Kultur regeln sensible Zeitordnungen, wie zu verhüten, empfangen und zu gebären ist. Dazu gehören der rechtzeitige Einsatz von Pille und Kondom, der Koitus an fruchtbaren Kalendertagen sowie die feingetaktete Überwachung einer Schwangerschaft.
Zeitdruck herrscht auch bei der Kehrseite dieser Lebensbereiche: dem freiwilligen Schwangerschaftsabbruch. Fristenregelungen bestimmen, bis zu welcher Deadline abgetrieben werden darf. In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist der Abbruch innerhalb der ersten 12 Wochen straffrei. Danach benötigt ein Abbruch ein ärztliches Urteil, das die Gesundheit der Schwangeren oder des Ungeborenen als stark gefährdet einstuft. Der Abort gilt ab der 22. bis 24. Woche als so prekär, weil der Fötus mit technischer Hilfe außerhalb des Mutterleibes überleben könnte. Bleibt er ungewollt, muss er ab diesem Zeitpunkt zunächst mit einer Kaliumchloridinjektion ins Herz getötet werden.
Was geschieht mit dem toten Fötus? Welche Emotionen, welche Personen begleiten die Abtreibung?
Die Abtreibung war schon immer ein „Geheimnis, das die Spatzen von den Dächern pfeifen“, so der Soziologe Luc Boltanski (2007: 40). Häufig praktiziert, häufig totgeschwiegen. Wer mehr dazu wissen will, ohne von Moral und Ideologie erschlagen zu werden, hat es schwer. Welche Geräte werden benutzt? Was spendet Trost? Was geschieht mit dem toten Fötus? Welche Emotionen, welche Personen begleiten die Abtreibung?
Auch die visuelle Kultur ist arm an Antworten. Selbst das Kino. Die Kulturwissenschaftlerin Julia Köhne (2018: 244) stellt hier Leerstellen fest, die „der Häufigkeit und Geläufigkeit der Praxis“ zuwiderlaufen. Es mangelt an filmischen Auseinandersetzungen, die nicht besserwisserisch, sondern fragend und tastend auf die Dilemmata hindeuten und Stigmatisierungen vorbeugen. Immerhin erweisen sich die wenigen einschlägigen Spielfilme als deutungsoffener und verspielter als zunächst vermutet.
Dazu zählt auch 24 Wochen von Anne Zohra Berrached – ein Film, der 2016 an den Internationalen Filmfestspielen in Berlin erstmals präsentiert wurde und mit dem Tabu des Spätabbruchs bricht. „Ich weiß, dass das jetzt beschissen ist“, meint einer der Ärzte im Film, während durch die Kinoreihen ein Schluchzen geht. Er bringt so auf den Punkt, was dem Film zu zeigen gelingt: Dass das Leben manchmal (zu) viel ist, dass man das irgendwie aushalten muss und dann nicht sicher wissen kann, was richtig oder falsch ist. „Wahrscheinlich ein bisschen beides“, resümiert die Protagonistin Astrid.
Hinweis: Die folgenden Abschnitte enthalten Angaben zur Handlung des Films 24 Wochen.
Astrid
Astrid (Julia Jentsch) ist eine erfolgreiche Komikerin, eine Person des öffentlichen Lebens. In Sketchen macht sie sich über ihren Babybauch lustig und zwischen den Zeilen stellt sie ihre genderspezifischen Zeitknappheiten ins Rampenlicht. Wie kann etwa eine Mutter die für das Showbusiness notwendige Fuckability aufrechterhalten? Astrid jedenfalls freut sich auf das zweite Kind und ihre weiteren Auftritte.

Ihre Frohnatur nimmt auch keinen Schaden, als das Ungeborene mit Trisomie 21 diagnostiziert wird. Erst als eine weitere Untersuchung ergibt, dass das Kind mit einem schweren Herzfehler auf die Welt kommen wird, gerät die Welt der toughen Eltern in eine Krise. Der Zeitdruck, über Leben und Tod zu entscheiden, wächst von Tag zu Tag, in welchen sich das Ungeborene zunehmend zu einem body that matters (Butler 1993) entwickelt.
Die Familie
„Irgendwie werden wir so zu Entscheidern über das Leben eines anderen Menschen,“ verzweifelt Vater Markus (Bjarne Mädel) und verkennt dabei, was bereits entschieden ist – durch Familie oder Arbeit. „Man muss ja heute solche Kinder nicht mehr auf Biegen und Brechen bekommen“, meint Astrids Mutter, die ihre Tochter vor jedem Zuviel bewahren möchte. „Wie wollt ihr das schaffen? Könnt Ihr Euch das zutrauen, ich meine, wenn ihr immer unterwegs seid?“ – „Ja, wir lieben Stress!“ antwortet Markus da noch selbstironisch. Ton und Bild greifen die Schlinge, die sich um den Hals von Astrid legt, ästhetisch auf. Während man an einer Baustelle miteinander über die Zukunft zu reden versucht, hämmern und bohren Maschinen. Immer wieder prasselnder Regen.

In Nahaufnahme fährt die Kamera über Vorhänge und Tagesdecken, Lichtstrahlen blitzen durch das Gewebe oder wir erblicken durch ihre Lücken die Außenwelt, wenn sich die Figuren unter den Stoffen verkriechen. Viele Handlungen spielen im engen Raum des Autos. Wenn wie ein Echo auf diese Szenen Close-Ups von Fötenhändchen im Fruchtwasser folgen, erinnert uns der Film, dass wir alle gewissermaßen embryonal bleiben: schutzbedürftig, angewiesen, ausgeliefert und auf der Suche nach einem bergenden Mutterleib.

Die Moral
Einen solchen postnatalen Uterus betritt das Paar beim Besuch einer Krankenhausstation für Frühgeburten, für die alles in dämmrig-roten Licht und im Flüstermodus gehalten ist. Doch auch hier ist Astrid den gesellschaftlichen Druck nicht los. Zwei Mütter erkennen den Promi und loben ihre Entscheidung, das Kind trotz medizinischer Indikation zu empfangen. Erneut muss sich die Komikerin dem moralisch gesellschaftlichen Zugriff erwehren: „Und was, wenn ich das gar nicht bekommen will? Gar nicht kann?“
Der Film präsentiert eine Studie über einen Prozess, dem die kulturellen Vorbilder und Techniken fehlen, mit der Belastung durch die ablaufende Frist umzugehen.
Der Film macht die Zwicklage spürbar, in der es nur ungute Entscheidungen gibt. Zugleich verweist er auf den brutalen Mangel gesellschaftlicher Räume, die einen unterstützen, dieses unlösbare Dilemma auszuhalten. Fernab von einer Kritik an Vater und Mutter präsentiert der Film eine Studie über einen Prozess, dem die kulturellen Vorbilder und Techniken fehlen, mit der Belastung durch die ablaufende Frist überhaupt umzugehen.
Der Beruf
Astrid versucht, ihre Comedy-Einlagen weiter aufzuführen. Live auf der Bühne ist keine Zeit für Zweifel, keine Zeit für Unsicherheit, keine Zeit für Traurigkeit. Im Scheinwerferlicht vor das Publikum geworfen bleiben Astrid die Worte im Hals stecken, sie flieht. „Für solche Befindlichkeiten ist es jetzt zu spät!“, ruft eine Redakteurin, „die muss jetzt raus! Die hat ´nen Vertrag unterschrieben!“ Als wäre das Fernsehstudio eine Gebärmaschine, die in knapper Zeit fehlerfrei produzieren muss. Wie in diese Welt ein Kind mit Down-Syndrom und Herzdefekt setzen?

Statistisch treiben 90 Prozent der Schwangeren bei einer Diagnose des Kindes mit Down-Syndrom ab. Gesprochen wird darüber so gut wie gar nicht. Dabei wäre ein Austausch, wie mit der abgelaufenen Zeit umzugehen und wie Abschied zu nehmen ist, wichtig. Ansonsten bleibt ungesagt, wie vorbehaltlose Hebammen helfen, wenn sie für die notwendige Trauerarbeit Fußabdrücke nach der stillen Geburt nehmen. Und wie tröstend der nicht-beschwichtigende Beistand nächster Personen ist. „Wie lange bleibst du?“ fragt Astrid Markus vor ihrem Eingriff. „Bis zum Schluss.“
Literatur
Berrached, Anne Zohra. 2016. 24 Wochen, Zero One Film et. al.
Boltanski, Luc. 2007. Soziologie der Abtreibung. Zur Lage des fötalen Lebens. Frankfurt am Main.
Butler, Judith. 1993. Bodies that matter. New York.
Köhne, Julia Barbara. 2018. „Absentes vergegenwärtigen. Schwangerschaftsabbruch und Fötalimagologie in westlichen Filmkulturen seit den 1960er Jahren“. Basaran, Aylin; Köhne, Julia B.; Sabo, Klaudija; Wieder, Christina (Hrsg.). Sexualität und Widerstand. Internationale Filmkulturen. Wien.
Bildnachweis
© Fabia Zindel, Matrix.
uncode-placeholder
Beate Absalon
Beate Absalon hat Kulturwissenschaft und Erziehungswissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin und Visual Cultures an der Goldsmiths–University of London studiert. Als Junior Fellow des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften in Wien steht sie am Beginn ihrer Promotion über eigensinnige Ästhetiken sexueller Bildung. Im Kollektiv „luhmen d’arc“ leitet sie Workshops zu Spielformen erfinderischer Intimität und hält davon inspirierte Reflexionen auf www.luhmendarc.blog fest