Vademecum
- Unsere politischen Ängste, Hoffnungen und Phantasien sind geprägt von populären Fiktionen.
- Filme wie Contagion, Outbreak oder Blindness verhandeln staatliches Handeln.
- Fiktionen schärfen das Kontingenzbewusstsein und entschärfen Notwendigkeiten.
Reale Katastrophen sind unübersichtlich. Was wirklich passiert ist, sieht man erst im Rückblick. Heute ist klar, was wir vor zwei, drei Wochen zu tun verpasst haben: Desinfektionsmittel hamstern, Aktiendepot auflösen, bloß keine Reise antreten. Stattdessen mokierten wir uns noch über die „Corona-Hysterie“. Die Lage ist derzeit unklar. Gerade weil das so ist, sind Prognosen fast unmöglich. Trotzdem konsumieren wir non-stop Hochrechnungen von Epidemiologen, Analysen von Börsengurus oder luftige Perspektiven von Meisterdenkern. Slavoj Zizek (2020) sieht – nun endlich! – das Ende des Kapitalismus heraufdämmern. Yuval Harari (2020) wittert den Durchmarsch einer Staatsmacht, die ihre Bürger bis in ihre körperlichen und affektiven Zustände hinein überwachen wird.
Aber all diese Einschätzungen zielen auf eine Zukunft, die kaum greifbar ist. Sie sagen nichts darüber aus, wie wir als Einzelpersonen betroffen sein werden, wie sich die Gesellschaften verhalten werden, in denen wir leben, und welche staatlichen Maßnahmen greifen werden. Kasernierung von Infizierten, wenn die Krankenhäuser zusammenbrechen? Geplünderte Supermärkte? Militärische Durchsetzung von Ausgangssperren? Flächendeckende elektronische Kontrolle der Bevölkerung wie in China? Massenarbeitslosigkeit und wirtschaftliche Rezession auf Jahre? Oder auch überraschende Formen der gesellschaftlichen Kooperation? Neue nachbarschaftliche Solidarität? Ein völlig neues Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft?
Drei politische Szenarien
Wo Prognosen schwierig sind, wendet man sich Geschichten zu, die ein „was wäre wenn.…?“ ausmalen. Kein Wunder, dass unter den derzeit am häufigsten heruntergeladenen Filmen auffällig viele Pandemie-Thriller sind. Ihnen geht es weniger um die frivole Lust an der Angst (Franzen 2020), als vielmehr um den Versuch, Sinn aus einer unverständlichen Situation zu machen. Wie werden sich die Nachbarn, die Bevölkerung, die Wissenschaftler, die staatlichen Organe in der Krise verhalten? Was könnte noch kommen?
Katastrophenthriller sind Szenarien.
Katastrophenthriller sind Szenarien. Sie sind keine Prognosen, sondern mögliche Abläufe, die verschiedene Varianten eines zukünftigen Geschehens ausleuchten. Als Gedankenexperimente bebildern sie, was wir in dieser völlig offenen Situation für möglich und denkbar halten – aber oft nicht offen aussprechen können. Soderberghs Contagion (2011), Petersons Outbreak (1995) und Meirelles‘ Blindness (2008) sind in diesem Sinne politische Phantasien, die staatliches Handeln im Pandemiefall durchspielen. Ihre drei unterschiedlichen Szenarien stehen exemplarisch für das, was derzeit erwartet, beargwöhnt und gefürchtet wird: den guten, den bösen und den abwesenden Staat.
Contagion: der gute Staat
Contagion erscheint uns gerade deshalb so nah an der Wirklichkeit, weil der Film sich vor allem für Ansteckungswege interessiert. So wirkt er streckenweise wie die Bebilderung dessen, was uns Prof. Drostens Podcast täglich über Handhygiene, Aerosolübertragung und R‑Null-Werte erklärt. Der Restaurant-Besuch einer amerikanischen Geschäftsfrau in Hongkong wird zur Geburtsstunde eines Virus, das auf den Spuren globaler Reise- und Warenwege schnell und letal um den Erdball wandert. Gegenspieler der Pandemie sind heldenhafte Wissenschaftler, denen es schon nach einem halben Jahr gelingt, einen Impfstoff herzustellen, aber auch eine maßvoll reagierende Staatsmacht, die die öffentliche Ordnung halbwegs aufrechterhält, ohne allzu repressiv durchzugreifen.
Der einzige Schurke im Film ist auf unheimliche Weise aktuell: Ein Blogger, der ein gefährliches Gemisch aus Verschwörungstheorien und Alternativmedizin verbreitet. Der Film aus der Obama-Ära ist durchdrungen vom Vertrauen in eine vorausschauende Regierung, ein funktionierendes Gesundheitssystem und die Wunder der Wissenschaft. Gerade deswegen, so scheint es, wird Contagion immer wieder als einigermaßen „realistische“ Blaupause der aktuellen Pandemie (Brier 2020) gepriesen.
Der Film aus der Obama-Ära ist durchdrungen vom Vertrauen in eine vorausschauende Regierung, ein funktionierendes Gesundheitssystem und die Wunder der Wissenschaft.
Outbreak: der böse Staat
Eine ganz andere Regierung malt der sehr viel action-lastigere Thriller Outbreak aus, in dem eine Ebola-ähnliche Seuche vom Militär zu einer Biowaffe weiterentwickelt werden soll. Um das Experiment zu vertuschen und die Seuche einzudämmen, löscht das Militär nicht nur ein afrikanisches Dorf aus, sondern plant auch, eine vom Virus befallene amerikanische Kleinstadt zu bombardieren. Die Abriegelung der Stadt wird mit brutaler Gewalt durchgesetzt und soll durchaus nicht die Bürger schützen, sondern die weitere Ausbreitung verhindern und die Rolle des Militärs vertuschen.
Inspiriert von den Biowaffen-Phantasien der 1990er Jahre gibt es in diesem Szenario eine ganz klare Scheidung von Schurken und Helden. Der Staat erscheint vor allem in Form des Militärs und damit einer Staatsraison, die keinen Moment lang zögert, die eigene Bevölkerung wie im Krieg zu behandeln. Das Interessanteste an Outbreak ist vielleicht, dass das Bombardement der Kleinstadt darin recht ausführlich erwogen wird: zweitausend Menschen opfern, um Millionen vor Ansteckung zu schützen? Am Schluss verhindert der Held das glücklicherweise, aber in der Diskussion wird eines klar: Im Notstand, den eine Pandemie darstellt, geht es nicht zuletzt darum, „tragische Entscheidungen“ zwischen zwei Übeln zu fällen, Entscheidungen darüber, wer geschützt und wer dem sicheren Tod preisgegeben werden darf. Was Outbreak damit behandelt, ist eine Logik des Ausnahmezustands mitsamt den fürchterlichen ethischen Dilemmata, die eine solche Katastrophe aufwerfen kann.
Was Outbreak damit behandelt, ist eine Logik des Ausnahmezustands mitsamt den fürchterlichen ethischen Dilemmata, die eine solche Katastrophe aufwerfen kann.
Blindness: der abwesende Staat
Ein drittes Szenario entfaltet der Film Blindness von Fernando Meirelles von 2008, kein Action-Blockbuster wie Outbreak, sondern die ebenso beklemmende wie ästhetisch subtile Verfilmung von José Saramagos Roman Die Stadt der Blinden von 1995. Geschildert wird hier eine Seuche, die nicht tötet, aber Menschen plötzlich erblinden läßt. Als die Epidemie sich ausbreitet, werden die hochansteckenden Blinden einfach im verlassenen Gebäude einer Nervenheilanstalt kaserniert, notdürftig mit Essen versorgt und sich selbst überlassen. Dort entfaltet sich dann das pure soziale Chaos. Eine gewalttätige Gang übernimmt die Kontrolle über die Nahrungsmittel, terrorisiert die Insassen und missbraucht die Frauen.
In Abwesenheit jeder äußeren Ordnungsmacht bildet sich hier eine regellose Gewaltstruktur, in der einzig das Recht des Stärkeren gilt. Als sich die Kasernierten schließlich aus der Anstalt befreien, merken sie, dass die Wachen, die sie zuvor mit Waffengewalt eingesperrt haben, längst abgezogen sind. Die Anarchie herrscht draußen ebenso wie drinnen, den Staat gibt es nicht mehr.
Drei politische Phantasien
Drei Szenarien, drei mögliche Abläufe, drei Phantasien darüber, wie die aktuellen Maßnahmen weltweit zu interpretieren sind und wie sich die ganze Sache weiterentwickeln könnte. Alle drei sind Gedankenexperimente über zwei zentrale Themen: Wie und mit welchen Mitteln wird sich der Staat der sich rasend schnell ausbreitenden Katastrophe stellen? Und wie werden sich die Einzelpersonen verhalten? In gewisser Weise stehen diese drei Fiktionen exemplarisch für das, was derzeit erwartet, beargwöhnt und gefürchtet wird. Es sind Phantasien über das Verhalten der Staatsmacht aber auch der Bürger im großen Laboratorium der Pandemie.
Es sind Phantasien über das Verhalten der Staatsmacht aber auch der Bürger im großen Laboratorium der Pandemie.
Es ist naheliegend, sich dabei ganz dem tröstlichen Szenario von Contagion zu verschreiben. Dieser Film glaubt an die Wunder der Wissenschaft und verdammt die gefährlichen Verwirrungen durch Fake News. Auch derzeit kursieren ja nicht wenige Schwachsinns-Theorien über Corona-Selbsttests im Netz („zehn Sekunden Luft anhalten“), ein gewisser Dr. Wodarg hält die Präventionsmaßnahmen für unnötige Hysterie und viele Amerikaner inklusive ihres Präsidenten trauen der Wissenschaft sowieso nicht. So buchstabieren jetzt etliche Kommentare die Kernmotive dieses Films nach: Sie akzeptieren recht fraglos die Maßnahmen der Regierung, hoffen aber, wie Zizek, auf eine Reform der Globalisierung, die die Verbreitung des Virus erst möglich gemacht hat – und, bei der Gelegenheit, gleich noch des Kapitalismus. Vor allem aber spricht aus ihnen ein erstaunliches Vertrauen darauf, dass die Allianz von Wissenschaft und Staat, ein ordentlicher Schub an Digitalisierung und eine irgendwie reorganisierte Gesellschaft nicht nur dem Spuk bald ein Ende machen, sondern auch eine verbesserte Welt nach Corona hervorbringen werden.
Nur wenige Stimmen sind da mißtrauischer und scheinen sich eher dem Szenario von Outbreak zu verschreiben. Hier ist der Staat der Feind, der die Bevölkerung ihrer Rechte beraubt und sie aus biopolitischer Staatsraison auch kontrolliert, einpfercht und notfalls vernichtet. Die Quarantäne-Maßnahmen werden als Ausnahmezustand und Aufhebung der Bürgerrechte verstanden. Viel Kritik bekam Giorgio Agambens Einschätzung (2020), die in Italien eingeführten Maßnahmen führten vor, wie der Staat die Pandemie als Vorwand für eine allgemeine Aushöhlung bürgerlicher Grundrechte nutzt.
In ein ähnliches Horn stößt aber auch der sehr viel besser informierte Yuval Harari, der davor warnt, dass die Maßnahmen der allgegenwärtigen digitalen Überwachung, mit denen China seine Infektionswelle derzeit in den Griff bekommen hat, nun zum weltweiten biometrischen Überwachungsstaat ausgebaut würden. Bemerkenswert dagegen ist, dass kaum jemand über die „tragischen Entscheidungen“ spricht, zu denen Pandemien auch zwingen können. Dass Ärzte in italienischen Krankenhäusern mittlerweile entscheiden müssen, welche Kranken sie intensivmedizinisch behandeln und welche sie einfach sterben lassen, ist genau so eine Art von Zwangsentscheidung, die man niemandem zumuten möchte. Solche Entscheidungen in der Öffentlichkeit zu diskutieren, ist fast undenkbar – wäre aber wichtig, um sie nicht einfach überforderten Individuen aufzubürden.
Solche Entscheidungen in der Öffentlichkeit zu diskutieren, ist fast undenkbar – wäre aber wichtig, um sie nicht einfach überforderten Individuen aufzubürden.
Das düsterste Szenario von allen aber ist das in Blindness. Hier ist der Staat schlichtweg abwesend. Die Abwesenheit jeglicher Ordnungsmacht und medizinischer Versorgung erzeugt eine Gewaltdynamik, die sich in der sich selbst überlassenen Notgemeinschaft entfaltet. Was übrig bleibt, ist tatsächlich „nacktes Leben“, rechtlose, eingesperrte Menschen, die nicht getötet, aber dem Sterben – und der Brutalität ihrer Mitgefangenen – preisgegeben werden.
Natürlich kommt niemand auf die Idee, dieses Szenario für realistisch oder auch nur wahrscheinlich zu halten. Aber das ist naiv. Aus Spanien erreichen uns Nachrichten, dass Altenheime von den Pflegern und Ärzten aufgegeben und die Insassen dort einfach dem Sterben überlassen wurden (BBC vom 24. März 2020). Die überfüllten griechischen Flüchtlingslager treiben unmittelbar auf eine humanitäre Katastrophe zu, wenn sie nicht schnellstens evakuiert werden. Und natürlich ist es kaum auszumalen, wie sich die Pandemie in Ländern abspielen wird, die nicht (wie wir in Europa) überforderte, sondern gar keine funktionierenden Gesundheitssysteme haben. Das ist es dann, was wir gern „unrealistisch“ nennen, einfach weil glücklicherweise weit weg und so schlimm ist, dass wir es lieber nicht imaginieren möchten.
Der Kontigenz bewusst sein
Die Corona-Krise ist ein Experiment mit offenem Ausgang. Bemerkenswert ist, wie stark die politischen Ängste, Hoffnungen und Phantasien, die sich an sie knüpfen, weniger von prognostischem Wissen als von populären Fiktionen strukturiert sind. Bemerkenswert ist aber auch, dass diese Fiktionen zum Teil die Situation mit sehr viel kühlerem Blick betrachten als die Kakophonie der derzeitigen Analysen und Prognosen. Sie stellen Fragen, die wir lieber nicht diskutieren wollen. Anders als im Kino wissen wir weder, wie die Sache laufen, noch wie und wann sie enden wird. Oder wie sie sich in unterschiedlichen Gesellschaften und Situationen ausspielen wird.
Was Hoffnung gibt, ist aber gerade die Offenheit des Ausgangs. Noch vor einem Vierteljahr waren die ehernen Gesetze der wirtschaftlichen Stabilität unantastbar. Ewiges Wachstum und Dauerkonsum, aber auch der Dauerstress eines ganz normalen Arbeitslebens voll sinnloser Geschäftsreisen erschienen alternativlos. Plötzlich sind sie es nicht mehr. Die aktuelle Krise, so bedrohlich und zerstörerisch sie ist, ist auch ein Training in Kontingenzbewußtsein: alles könnte anders sein als wir geglaubt haben. Vieles ist möglich. Und das ist nicht nur eine Drohung, sondern könnte auch ein Versprechen sein.
Was Hoffnung gibt, ist die Offenheit des Ausgangs.
Literatur
Agamben, Giorgio. 2020. „The state of exception provoked by an unmotivated emergency“. Positions. Online.
Brier, Ronja. 2020. „Vor 9 Jahren gab es das Virus schon mal – in Hollywood“, Bild am Sonntag vom 22. März 2020. Online.
Franzen, Johannes. „Niemand ist immun gegen Bilder“. ZEIT Online vom 29. Februar 2020. Online.
Žižek, Slavoj. 2020. Im Interview. „Das Ende der Welt, wie wir sie kennen? Corona als Herausforderung und Chance einer globalisierten Welt“. Das Erste vom 22. März 2020. Online.
Bildnachweis
© Fabia Zindel, Matrix.
uncode-placeholder
Eva Horn
Eva Horn ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, sie forscht und lehrt in Wien. 2014 erschien von ihr Die Zukunft als Katastrophe. Darin analysiert sie Katastrophennarrative von der Romantik bis in die Gegenwart und legt eine ganze Anthropologie des Desasters frei. Jüngst verfasste sie zusammen mit Hannes Bergthaller Anthropozän zur Einführung (2019). (Foto: Helmut Grünbichler)



















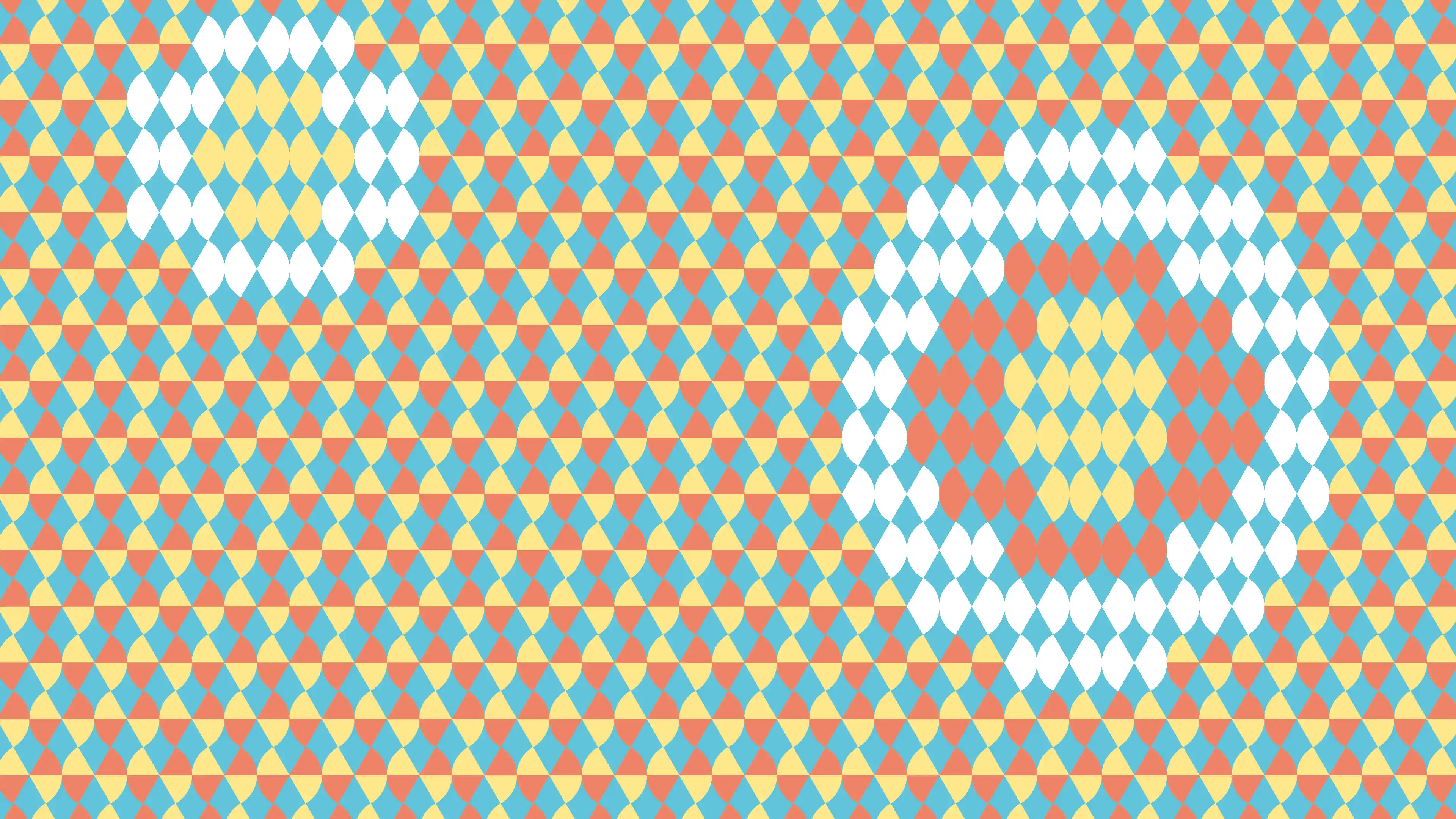
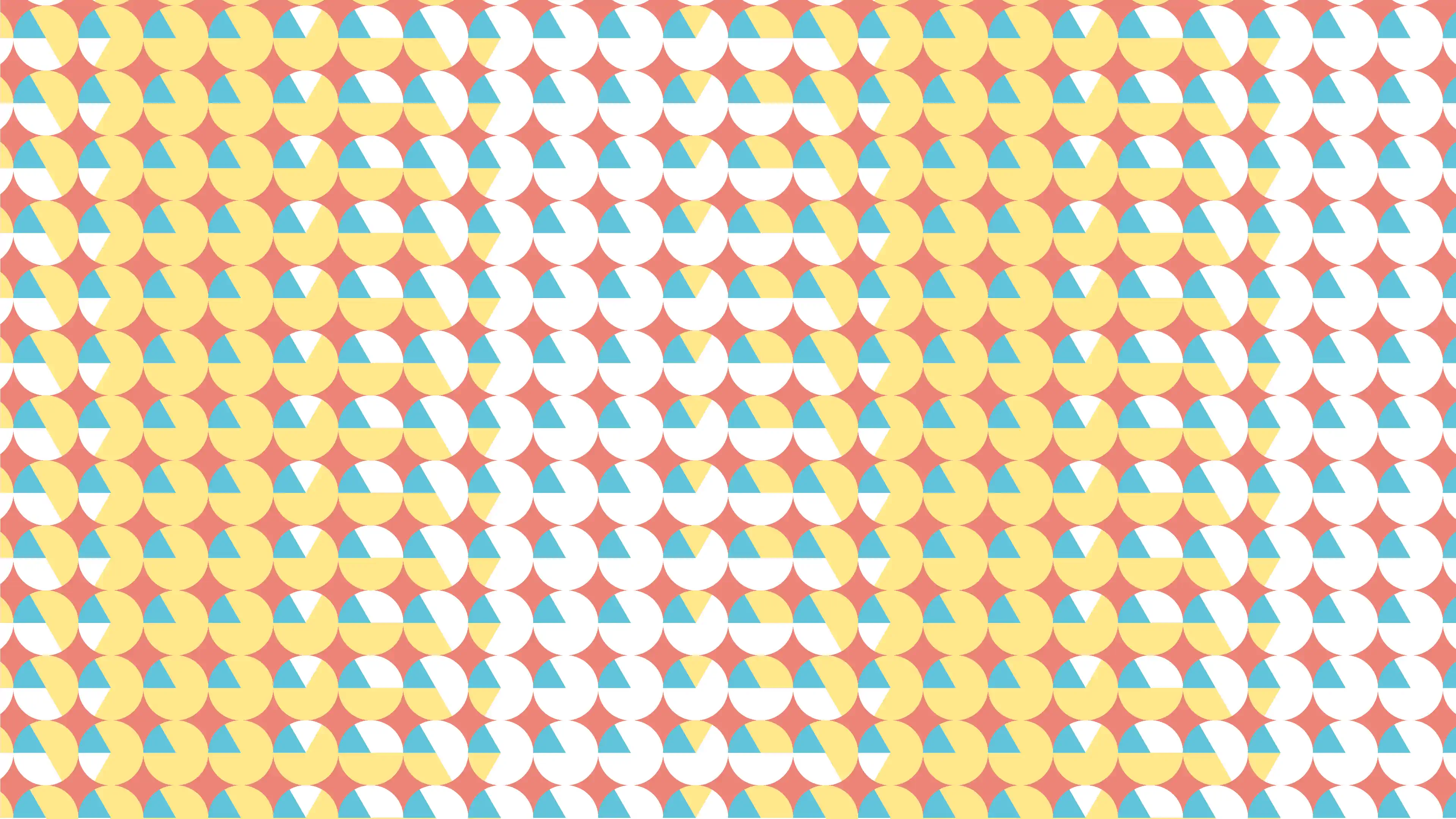
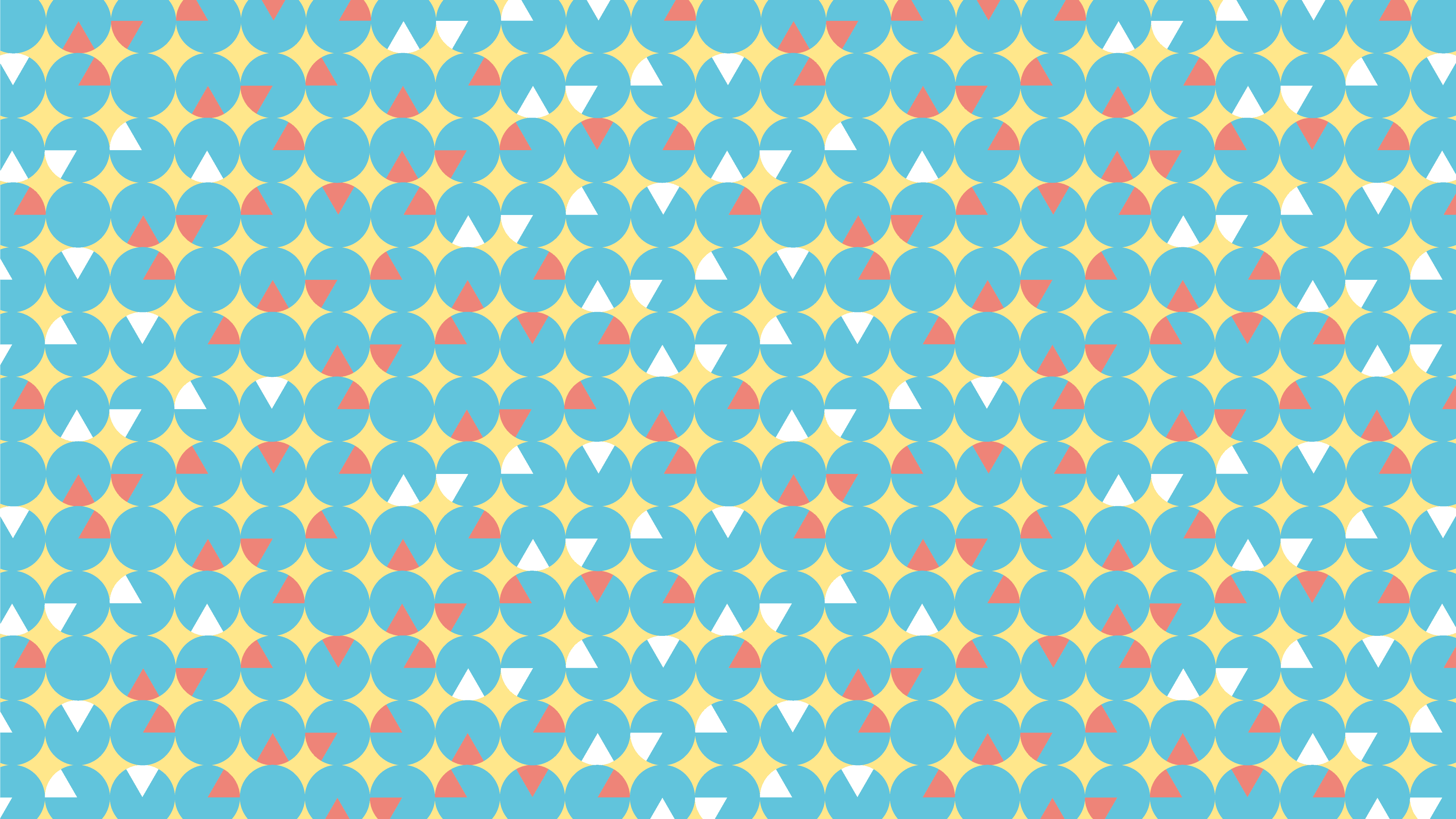


So flott der Satz klingt, aber die Corona-Krise ist kein Experiment. Als Experiment kann höchstens unser Umgang mit dem Virus bezeichnet werden.
Kontingenz ist ein wichtiger Schlüsselbegriff – wenn man sich der Unsicherheit und dem Nicht-Wissen mehr denn je ausgesetzt sieht. Wer sich in seiner Existenz bedroht sieht – fragt vielleicht auch anders nach der Essenz des Ganzen. Das kann auch heilend wirken und beruhigen. War es denn je einsehbar? Also, warum auch gerade jetzt – die Kluft war immer schon da
So zeigt eine existentielle Krise ja immer auch auf die Grenzen einer möglichen Essenz – eines nur möglichen AlsOb in der Kontingenz des Seins und dadurch werden neue Konzepte von politischen ökologischen und ökonomischen Realitäten und Identitäten verhandel- und problematisierbar – so hofft man doch gerne darauf, dass es eine Chance darstellt
Liebe Frau Horn,
einerseits scheint es ganz selbstverständlich, dass Narrative wie die von Ihnen behandelten Filme ordnend und im Vergleich zur Realität simplifizierend sind – denn eben genau das macht sie ja zu Narrativen.
Andererseits scheint mir aber auch die Pointe ihres Artikels, das Lob der Kontingenz, (ebenfalls als Narrativ) nicht anders zu verfahren. So wohlig ich es auch fände, einem „Versprechen der Kontingenz“ Glauben zu schenken, so sehr scheint es mir im Gegensatz dazu notwendig, auf bestimmte Narrative zu lauschen: auf die eben ganz und gar nicht kontingenten, sondern vielmehr machtvoll ordnenden Eingriffe, die staatlichen Machtdemonstrationen, bei denen man hinsichtlich der Eindämmung von Covid-19 erst noch eruieren muss, was wirklich nötig war und was vielmehr Gute-Nacht-Märchen vom „starken Staat“ waren, die unter dem Deckmantel der Volksfürsorge auf etwas ganz anderes abzielen.
Nun ist das, was ich hier gerade geschrieben habe, auch ein Narrativ, sicherlich… weil wir uns eben nicht anders als in solchen verständigen können. Da wir aber in der anstehenden Post-Corona-Phase in Fragen der staatlichen Narrative viel zu verhandeln haben, könnte ich mich momentan nicht in die Hängematte eines Kontingenz-Versprechens legen…
Lieber schaue ich noch ein paar dystopische Filme à la „Outbreak“, um im besten Fall positiv überrascht zu werden, dass dann doch alles (und sogar die staatlichen Machtlegitimationen) gar nicht so heiß gegessen wie gekocht werden.
Beste Grüße