Vademecum
- Prepper bereiten sich auf ein Leben nach dem Kollaps der öffentlichen Ordnung vor.
- Medien stellen Prepper als rechte Paranoiker oder exotische Paramilitärs dar.
- Doch Preppen ist längst zur zweifelhaften Tugend der gesellschaftlichen Mitte geworden.
Prepper bereiten sich auf Krisen vor. Es handelt sich um eine lose Bewegung, die sich in den USA formiert, seit 2009 auch in Europa gut Fuss gefasst hat. Die Krisenszenarien reichen von Naturkatastrophen über Pandemien bis hin zu Bürgerkriegen aufgrund einer „Umvolkung“. All diese Krisenszenarien eint ein Muster. Ein Ereignis setzt eine Kettenreaktion in Gang, in einem Kollaps der Infrastrukturen und öffentlichen Ordnung, kurz, in einem bürgerkriegsähnlichen Zustand mündet.
Im Rahmen eines kulturanthropologischen Forschungsprojekts interviewe ich Prepper in Deutschland und der Schweiz.
Das banale Leben der Prepper
Ziel von Preppern ist es, im Krisenfall möglichst autark zu sein. Deshalb horten sie nicht nur Lebensmittel und Wasser, sondern auch Hygieneartikel, Medikamente, Kerzen, Wasserfilter, Gaskocher, Akkus und dergleichen mehr. Hinzu kommen je nach dem Alkohol, Zucker und Zigaretten als potenzielles Tauschgut und Ersatzwährung nach dem Krisenfall.
Was und wie viel Prepper einlagern, hängt von ihren finanziellen Möglichkeiten und Platzverhältnissen ab. Meine ausschließlich männlichen Gesprächspartner wollen sich mindestens drei Monate selbst versorgen können. Zum Vergleich: Deutschland empfiehlt Notvorräte für zehn, die Schweiz für sieben Tage. Wer gut preppen will, muss also tief in die Tasche greifen. Gerald* berichtet von über hunderttausend Euro, die er in Reserven für ein Jahr und drei Personen investiert hat.
Lebensmittel horten Prepper auf zwei Arten. Entweder kaufen sie sich für viel Geld haltbare Spezialnahrung bei einschlägigen Anbietern oder sie decken sich im Supermarkt mit Konserven, Teigwaren und Reis ein. Im Sinne einer klassischen Vorratshaltung konsumieren sie die Vorräte mit begrenzten Ablaufdatum und stocken sie mit frischen Waren wieder auf. Wie wichtig und richtig der Besitz von Waffen ist, ist bei deutschen Preppern zumindest umstritten. In der Schweiz hingegen scheint die Waffe selbstverständlicher Bestandteil der eigenen Krisenvorsorge zu sein.
Zur Standardausrüstung gehört auch ein sogenannter Fluchtrucksack, im Jargon BOB für „bug out bag“ oder I.N.C.H. für „I never come home (again)“ bezeichnet. Die Rucksäcke enthalten das Nötigste für ein paar Tage und stehen üblicherweise fertig gepackt bereit.

Für meine Gesprächspartner besteht Vorbereitung nicht primär darin, Vorräte und Ausrüstung anzuhäufen. Vielmehr geht es um eine kontinuierliche und minutiöse Auseinandersetzung mit Krisenszenarien. Diese werden fortlaufend entwickelt, verfeinert und auch im Alltag trainiert, um Schwachstellen in der eigenen Vorbereitung ausfindig zu machen. Einige meiner Gesprächspartner stellen Ihrer Familie einmal im Jahr Strom und Heizung ab, um die Vorbereitung zu testen.
Einige meiner Gesprächspartner stellen Ihrer Familie einmal im Jahr Strom und Heizung ab, um die Vorbereitung zu testen.
Geübt werden auch Fluchtszenarien: Marc hat gemeinsam mit zwei Freunden Fluchtrouten und Treffpunkte definiert. Hans hat nebst seinem Heimvorrat Plastikfässer mit weiteren Vorräten im Wald vergraben. Michael, Vater von zwei kleinen Kindern, hat Rucksäcke für die ganze Familie gepackt und übt mit ihr das Tragen. Im Krisenfall möchte er ein abgelegenes Grundstück erreichen, wo weitere Vorräte eingelagert sind. Thomas legt lange Märsche mit schwerem Gepäck zurück. Rudolf lernt mit seinem Sohn, sich nachts mit Infrarotschutz ausgerüstet unentdeckt und getarnt zu bewegen. Sollten Rucksack und Vorräte außer Reichweite sein, tragen die meisten meiner Informanten ein EDC (für „every day carry“) auf sich, der meistens Messer, Wasseraufbereitungstabletten, Feuerstahl und Taschenlampe umfasst.
Weniger spektakulär aber nicht minder wichtig ist es für meine Gesprächspartner, einen Überblick über die Vorräte zu behalten. Ablaufdaten müssen im Auge behalten, der Zustand von Lebensmitteln überprüft, Akkus gewartet und die Funktionsfähigkeit von Ausrüstung getestet werden. Wer wie Gerald besonders viele Vorräte eingelagert hat, kommt um eine Revision in regelmäßigen Abständen kaum herum.
Prepper am medialen Abgrund
Wie so viele andere Phänomene, die die Schwelle zum Massenkommerz überschritten haben, kommt Preppen in der Öffentlichkeit und den Medien ambivalent weg: Das Phänomen wird exotisiert, pathologisiert und skandalisiert: In der Reality-TV-Sendung Doomsday Prepper und zahllosen Zeitungsartikeln erscheint Preppen als aufregend-fremd-neuer Lebensstil, als Faszinosum der Gegenwartsgesellschaft. Im Schlepptau der Exotisierung taucht üblicherweise die Sorge um die psychische Gesundheit von Preppern auf. Sind die nicht einfach alle paranoid und irrational?
Sind die nicht einfach alle paranoid und irrational?
Diese Frage verkennt, dass wir alle nicht rational im Sinne eines ökonomischen Kalküls handeln. Bei 35 Grad in Anzug oder Kostüm zu arbeiten, ist – rational gesehen – alles andere als rational. Räume zu klimatisieren, damit das trotzdem erträglich ist, ist noch abstruser – von den unzähligen Widersinnigkeiten eines Büroalltags ganz zu schweigen. Trotzdem käme niemand auf die Idee, die überkleideten Arbeitnehmer*innen als geisteskrank und irrational abtun.
Das Spektrum der medialen Stereotypen, das vom faszinierenden Typen zum paranoiden Spinner reicht, hat sich jüngst um die Facette des rechtsextremen Gefährders erweitert. Teile der Prepper-Szene stehen in Deutschland seit Ende 2017 unter der Beobachtung des Verfassungsschutzes. Es gab und gibt Razzien, Gerichtsprozesse und Untersuchungsausschüsse. Auf den Anklagebänken befinden sich auch preppende Polizisten, (ehemalige) Bundeswehr- und KSK-Soldaten. Es geht um Verschwörungstheorien, mutmaßliche Todeslisten, angebliche Anschlagspläne, paramilitärische Trainings und illegalen Waffenbesitz.
„Hannibal-Netzwerk“, „Gruppe Nordkreuz“, „Uniter“ und „Franco A.“ fungieren in den Schlagzeilen als Chiffren, hinter denen sich Abgründe auftun: Hass auf alles Andersartige, Fremde und angeblich Links-Grün-Versiffte, Verachtung der demokratischen Grundordnung und ein kaum verhohlener Wille zur Machtergreifung. Gleichzeitig fungiert der „Tag X“, an dem die Welt zusammenbricht, für diese Gruppierungen als Sehnsuchtsort, an dem ruhmreiche Heldentaten möglich sind, die deutsche Nation als starkes Volk auferstanden und das Abendland vor dem Untergang gerettet sein wird (vgl. taz vom 16. Nov. 2018). Müssig zu erwähnen, dass diese rechtsextremen Netzwerke auch in der Schweiz und Österreich aktiv sind.
Da Preppen den politischen Ausnahmezustand beschwört, den Mann als heroischen Beschützer und Ernährer seiner Familie imaginiert und …
Meine bisherigen Gesprächspartner gehen zu diesen Fällen auf Distanz. Zum einen habe Preppen nichts mit Politik zu tun, zum anderen sei es falsch, alle Prepper in die rechtsextreme Ecke zu stellen. Diese Distanzierungsbemühungen deuten für mich weniger auf einen tatsächlichen Abstand als vielmehr auf eine unheimliche Nähe hin. Da Preppen den Ausnahmezustand beschwört, den Mann als heroischen Beschützer und Ernährer seiner Familie imaginiert und der militärischen Tradition Denkfiguren, Jargon und Ausrüstung abringt, lässt die Bewegung – so lose und divers sie auch sein mag – neokonservative Tendenzen erkennen.
Preppen in der politischen Mitte
Das Wechselspiel von unheimlicher Nähe und gesuchter Distanz lässt sich freilich auch ketzerisch wenden: Bedeutet nicht das Stereotyp vom Prepper als Exot, Paranoiker und Rechtsextremer, dass es sich um ein Phänomen ganz weit weg von der vielbeschworenen Mitte der Gesellschaft handle? Nein.
Wenn ich mit Menschen über mein Forschungsprojekt spreche, ernte ich nicht selten ein ernsthaftes Staunen darüber, dass meine Gesprächspartner tatsächlich auch so unverdächtig banale Dinge tun wie einem Beruf nachzugehen, in einem Haus zu wohnen oder Kinder groß zu ziehen. Die Idee, dass es zum Preppen zwar keine genetische, aber wenigstens eine psychopathologische Veranlagung braucht, die ein „normales“ Leben – was auch immer das sein soll – ohne Leidensdruck verunmöglicht, hält sich hartnäckig. Die Distanznahme zu Preppern durch ihre Stereotypisierung täuscht hier über eine unheimliche Nähe zur viel beschworenen Mitte hinweg. Preppen ist mitnichten ein isoliertes, höchstens zu rechtsextremen Kreisen anschlussfähiges Phänomen.
Immerhin genießen wir den Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung fast tagtäglich. In der Serie der Walking Dead schlägt sich seit nunmehr elf Staffeln eine Gruppe Überlebender durch die Zombieapokalypse. Wer es weniger blutig mag, kann in Cast away an Tom Hanks Überleben auf der einsamen Insel partizipieren. Noch interaktiver können wir uns mithilfe von Computerspielen auf das Leben nach dem Untergang vorbereiten: Kein anderes Gerne verzeichnet seit Jahren eine so große Vielfalt und einen so hohen Zuwachs wie das Survival-Game. Dazu gehören Klassiker wie Alone in the Dark, Resident Evil oder Fallout, die bereits in den 1990er Jahren die Spieler*innen auf ein Leben nach der Apokalypse einschworen. Die wahre Explosion erfolgte jedoch in den letzten zehn Jahren mit Titeln wie DayZ, 7 Days to Die, Green Hell, Don’t Starve, Rust, Metro 2033.
Postapokalyptische Szenarien dienen jeweils als Bühne für heroische Einzelkämpfer*innen, die jede noch so ausweglose Situation meistern. Erstaunlich daran: Viele dieser Spiele beruhen auf literarischen Vorlagen, die als climate fiction oder als Katastrophenfiktionen (vgl. Interview mit Eva Horn) seit Jahren eine immer grössere Leserschaft finden. Der einsame Held ist überdies Thema vieler Survival-Sendungen, in denen Ex-Militärs wie Bear Grylls zeigen, was es zum Überleben in der Wildnis braucht. Zu Gast war übrigens auch schon Roger Federer – mehr Mitte geht kaum.
Prepper, so zumindest meine Erfahrung, sind keine Untergangsfanatiker. Was meine Gesprächspartner an der Auseinandersetzung mit Krisenszenarien reizt, ist die Idee, unter allen Umständen handlungsfähig und damit auch unabhängig zu sein. Dies ist kein abseitiges Ideal, im Gegenteil. Die Eigenschaften, die meinen Gesprächspartnern zufolge für ein Überleben in einer Krise entscheidend sind, unterscheiden sich überraschend wenig von den Normen und Wertvorstellungen der gegenwärtigen Arbeitswelt. Der fähige Prepper ist ein Visionär, der unerschrocken in die Zukunft blickt, ein Macher, der Dinge anpackt und die Herausforderung nicht scheut, ein Manager, der mit knappen Ressourcen jongliert und sich in einem kompetitiven Umfeld behauptet, ein Realist, der bereit ist, sich seinem Schicksal zu fügen und zugleich das Beste daraus zu machen. Bestes Indiz dafür ist, dass zahlreiche Survival Trainer auch als Motivationsrendner und Coaches von Firmen gebucht werden.
Preppen ist längst zur Tugend der politischen Mitte in einer regressiven Moderne mutiert.
Preppen ist gerade nicht das exotische Andere und das bedrohliche Außen der Gegenwartsgesellschaft. Preppen ist längst zur Tugend der politischen Mitte in einer „regressiven Moderne“ (Nachtwey 2016) mutiert.
Hinweis
* Die Namen der erwähnten Gesprächspartner wurden geändert.
Literatur
Nachtwey, Oliver. 2016: Die Abstiegsgesellschaft. Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne. Berlin.
Bildnachweis
© Fabia Zindel, Matrix.
uncode-placeholder
Julian Genner
Julian Genner studierte Europäische Ethnologie, Philosophie und Geschichte in Basel. 2015 promovierte er in Kulturanthropologie mit einer Arbeit über Nacktscanner, für die er den Preis der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Basel erhielt. In seinem aktuellen Forschungsprojekt Die Zukunft überleben untersucht er Preppen aus kulturwissenschaftlicher Perspektive.






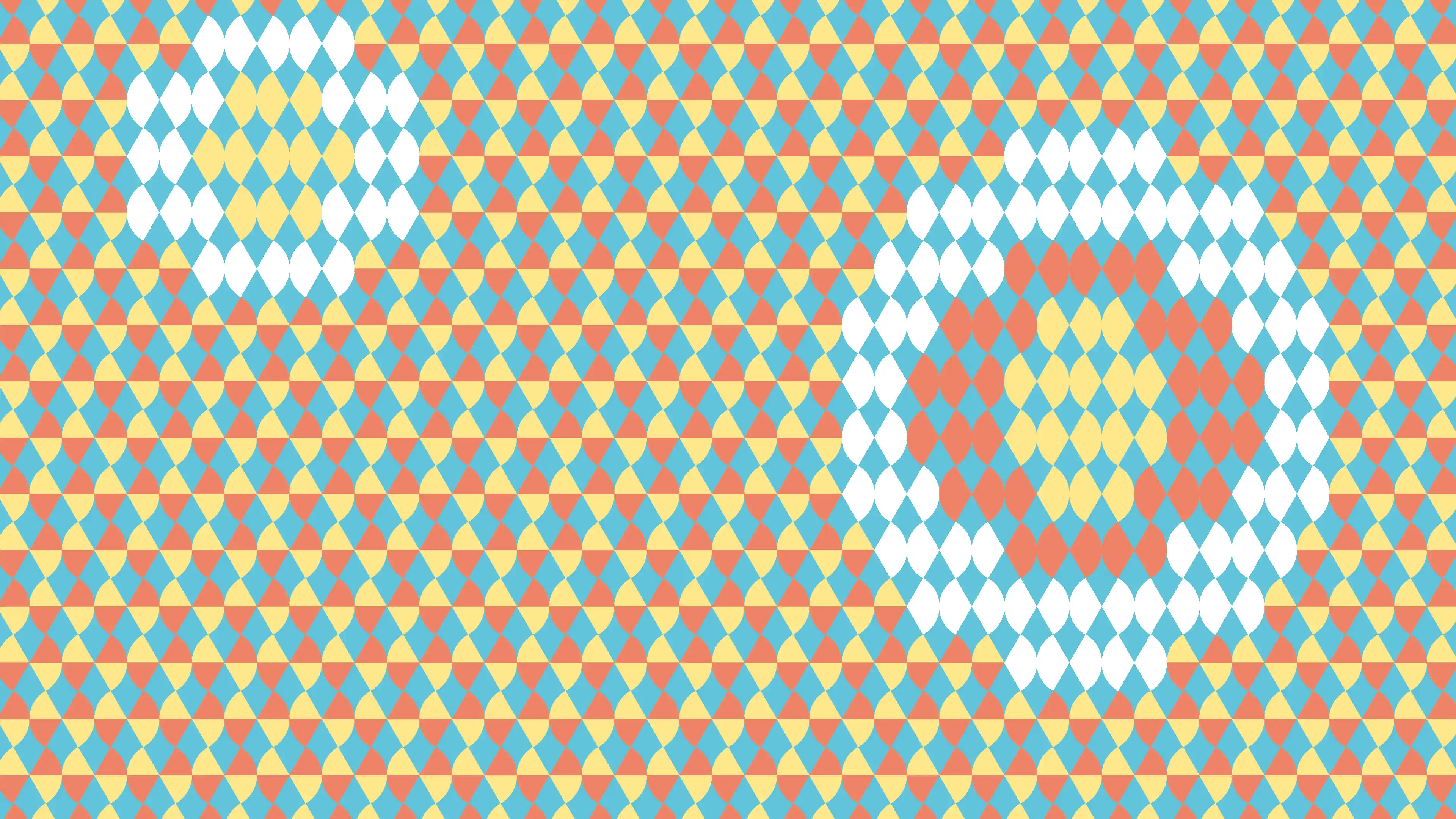
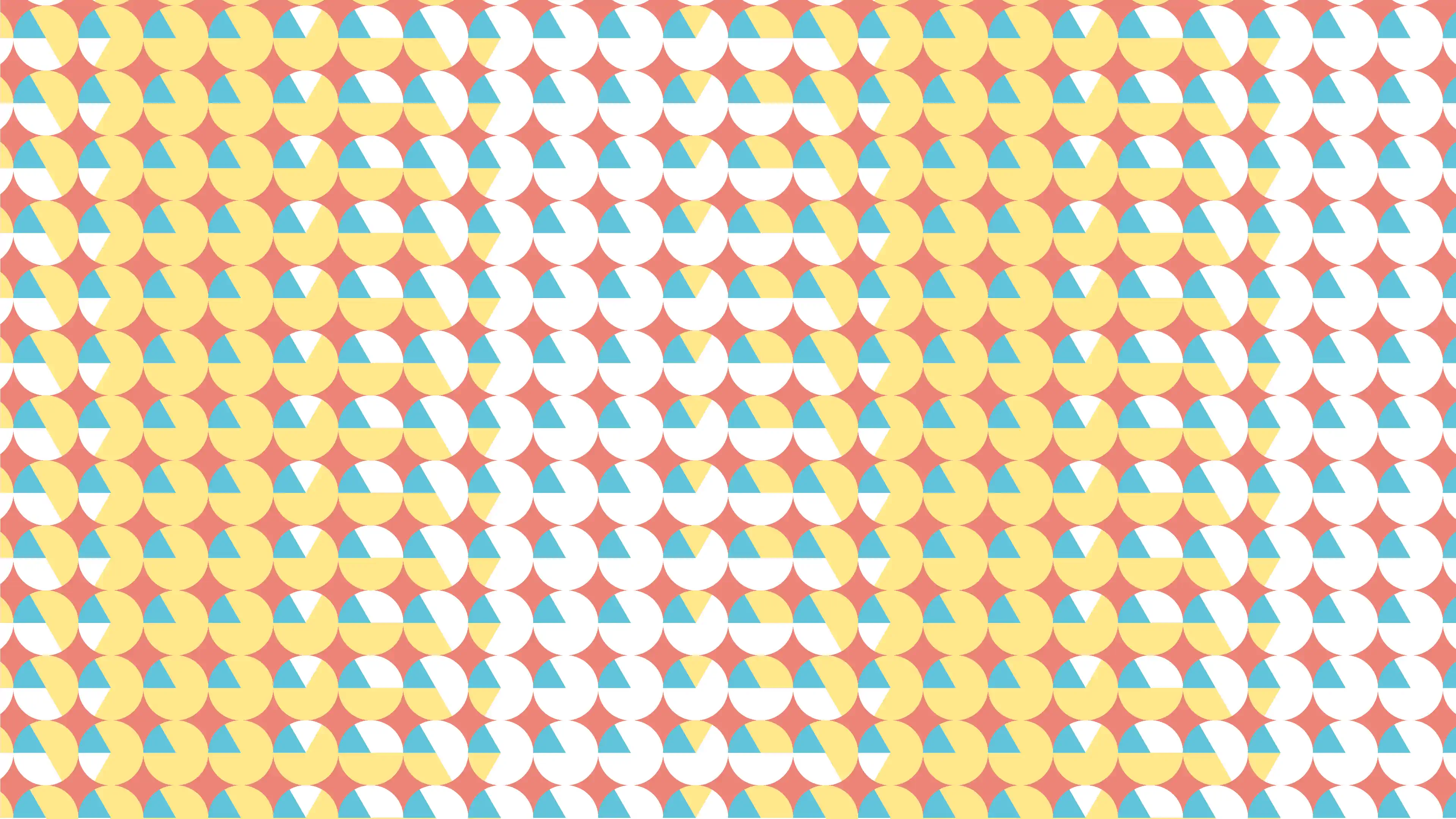



Gerne möchte ich kurz auf die Fragen, sind Prepper politisch rechts kurz eingehen: Soweit ich sehe, ist für das Erwachen des Preppers ein Bedrohungsszenario vorausgesetzt, das nicht näher definiert wird. Es scheint aber, als müsse die Welt ziemlich aus den Fugen geraten. Eine Virus-Pandemie, wie wir sie derzeit erleben, reicht offensichtlich noch nicht aus. Man gewinnt vielmehr den Eindruck, dass der Schwellenwert dort erreicht wäre, wo der Prepper als Held und Retter einer auserwählten Schar in Erscheinung treten kann. Damit kommt das Narrativ den klassischen Mythenstoffen nahe, wie sie wohl auch die im Beitrag genannten Filme oder Serien repräsentieren. Gleichzeitig mag dies auch die stabile Assoziation mit rechtsextremen und/oder anderen verschwörungstheoretischen Erzählungen erklären. Denn diesen modernen (wie bereits den antiken) Mythen ist gemein, dass sie keiner logischen Deduktion bedürfen, dafür stark emotional aufgebaut sind, was sich leichter in Bildern, als in Schrift ausdrücken lässt und auf Ursprüngliches, wie den urzeitlichen Jäger oder vergleichbar romantische Figuren rekurrieren, freilich nur in ahistorischer Gestalt. Dies veranlasste den Theologen Paul Tillich 1933 zu der Aussage: „das ursprungsmythische Bewusstsein [ist] die Wurzel alles konservativen und romantischen Denkens in der Politik“. Dies trifft auch auf Narrative der Prepper zu.
Ethnologen und Soziologen: wie Sportreporter, die in gesicherter Distanz mitrennen und das entdeckte Elend der inneren und äusseren Wilden, die zu jeder Herrschaftsstruktur gehören, akribisch beschreiben und reportieren. Seit bald 200 Jahren. Und man hat den Eindruck, das geht ewig weiter so. Warum tun sie das bloss?
Sehr geehrter Herr Genner,
wir, ein Lektürekreis Wiener Germanist*innen, haben bei unserem letzten Treffen Ihren Prepper-Text diskutiert. Da es recht heftig herging, konnten wir die gesammelten Anmerkungen nicht mehr den einzelnen Diskutant*innen zuordnen, weshalb wir hier einen Sammelkommentar hinterlassen wollen:
Ein wenig stutzig haben uns manche Ihrer Vergleiche und Metaphern gemacht. So ist zwar der/die Anzug- oder Kostümträger*in bei 35 Grad mit Sicherheit ein äußerst groteskes Wesen; der Vergleich mit Prepper*innen hinkt jedoch, werden die Kostümträger zu diesem Verhalten doch eher aufgrund eines Glaubens an gesellschaftliche Rituale und ihre stabilisierende Wirkung motiviert, während den/die Prepper*innen ja gerade das Gegenteil anfeuert. Die hier von Ihnen bezweckte Neo-Liberalismus-Kritik ist uns eigentlich willkommen – sie müsste dann allerdings schon in ihrer Bildlichkeit stringent sein.
Ebenso haben wir lang über die Hauptmetapher Ihres Artikels gesprochen und festgestellt, dass ein Ankommen der Prepper*innen in der »Mitte« doch ein eher schräges Bild ist. Was wäre die Mitte einer Gesellschaft, wenn sich dort eine Ideologie als anschlussfähig beweisen würde, die nicht an den Zusammenhalt dieser Gesellschaft glaubt? Wir wären da bei W. B. Yeats mit seinem »the centre cannot hold; / mere anarchy is loosed upon the world« (‚Second Coming‘) und damit nicht bei einer Neuformierung, sondern einem Verfall des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Die Mitte einer Gesellschaft kann nicht diejenigen integrieren, die nicht an deren Zusammenhalt glauben. Das wäre als Gesellschaftsbild im harmlosesten Fall paradox, im Ernstfall gefährlich.
Es ist ja die Frage, was in den Augen der Prepper*innen der Staat noch sein kann. Ein Sozialstaat ist er mit Sicherheit nicht, doch was ist er dann? Die Frage wäre freilich auch anders zu stellen: Ist die Ablehnung der Prepper*innen gerechtfertigt und der Staat gar nicht mehr sozial, was nicht zuletzt durch die von Ihnen angeführten Beispiele staatlicher Anleitungen zum Survivalism, aber auch von uns diskutierte Veranstaltungen des österreichischen Zivilschutzverbandes impliziert wäre? Mit welchem Fokus man die Frage stellt, die Antwort wäre jedes Mal nicht die Integration in, sondern die Dekonstruktion einer gesellschaftlichen Mitte.
Insgesamt schien uns die schwelende Apokalyptik in den Denkweisen der von Ihnen Interviewten die größte Fantastik von allen. Selbst Szenarien wie in ‚Walking Dead‘ oder ‚Cast Away‘ erzählen ja nicht von einem Niedergang, sondern einem Fortbestand der Gesellschaftlichkeit, in der ein Sheriff nun mal ein Sheriff und ein Volleyball ein Gesprächspartner ist. So ist die Extremausprägung der Prepper*innen, die meinen, dass man als Einzel- oder aber auch Familienkämpfer*in der postapokalyptischen Nachwelt ohne gesellschaftliche Absicherungen überleben könnte, eigentlich ein noch viel größeres Wahnbild als das der popkulturellen Narrative. Um Entsprechungen zur Fantastik des Prepper*innen-Narrativs zu finden, muss man wohl eher auf die religiöse Apokalyptik schauen.
Deshalb kamen wir letztendlich zu der Frage, was denn falsch oder verwerflich sein sollte an der Exotisierung und Pathologisierung von Prepper*innen. Wir alle kennen diese Denkformen auch aus (vermeintlich) ›linken‹ Lagern, weswegen maximal die Pauschalbezeichnung als ›rechts‹ unangemessen wäre (zumal apokalyptische Szenarien sich ohnehin wohl kaum um parlamentarische Raumaufteilungen scheren). Die Exotisierung schien uns ganz im Gegenteil zwingend notwendig: Ideologien, die den Zusammenhang einer Gesellschaft negieren, muss man als das ›Randständige‹ dieser Gesellschaft betrachten können, wenn man weiter an deren Beständigkeit glauben will.
Ich hoffe, Sie können mit unseren Gedanken etwas anfangen. Wir jedenfalls hatten einen ergiebig hitzigen Abend mit Ihrem Text. Vielen Dank dafür.
Mit besten Grüßen
Simon Angerer
Matthias Däumer
David Hell
Markus Hofmann
Catharina Marinica
An den Herrn Genner und den Wiener Lektürekreis „Der Trinker“:
Ist es aus Ihrer Sicht ein sinnvolles Verhalten, mit dem Mittel der Diskriminierung von „Minderheiten“ gegen die Diskriminierung von „Minderheiten“ anzugehen?
Herr Genner, was ist aus Ihrer Sicht der Unterschied der beiden Sätze „X ist blau“ und „X ist nicht blau“? Sind Prepper (politisch korrekt: Prepper*innen) nun psychisch krank oder nicht psychisch krank? Genetisch bedingt oder nur eine psychopathologische Anlage? Gibt es bereits eine ICD-Diagnose? Wenn nicht, bis wann ist diese zu erwarten? Geht es nur um paranoide Störungen oder auch andere psychische Krankheiten? Sind diese ansteckend? Weiss man da schon genaueres? Was sagen die Daten? Sind psychisch Kranke*innen gefährlich? In meinem Quartier sind mir schon des öfteren psychisch aufällige Menschen*innen aufgefallen. Was muss ich tun? Die Polizei und die Psychiatrie anrufen oder genügt es im Moment noch die Strassenseite zu wechseln? Kennen Sie Michel Foucault?
Lieber Lektürekreis, meine medialen Highlights der „Lockdown“-Zeit sind diese (gestaffelt nach Bildungsstand):
1. https://www.youtube.com/watch?v=Qu9P5DR3srA (SRF-Beitrag)
2. https://www.journal21.ch/im–schlamm–des–irrsinns
3. https://www.bluewin.ch/de/news/wissen–technik/die–gefaehrliche–allianz–zwischen–krise–und–verschwoerungsglaube–392577.html („Verschwörungsmentalität“)
4. https://www.srf.ch/news/international/waechst–die–anhaengerschaft–man–darf–verschwoerungstheoretiker–nicht–als–irre–abtun
Ich habe irgendwann verstanden, dass die Absprechung der Verstandes- und Vernunfttätigkeit (meiner „Minderheit“ gegenüber durch die Gesellschaft, Wissenschaft usw.) nicht ein Moment der Unterdrückung ist, sondern ein Moment der Freiheit. Zumindest in dieser Gesellschaft. Es ist daher egal, ob ich von den Rechten als „Scheininvalider“ oder von der gesellschaftlichen „Mitte“ als „Asset“ bezeichnet werde (oder wie auch immer). Es ist egal.
Ich möchte die Gedanken meiner Wiener KollegInnen noch dahingehend ergänzen, dass man m.E. kein großes Geheimnis daraus machen muss und keine Mythen oder religiöse Apokalyptik zur Beschreibung des Phänomens braucht, sondern man die Dinge historisch schon klar beim Namen nennen kann: Offensichtlich folgen Prepper weiterhin dem alten kolonialistischen Traum, allerdings nach seinem Ende, in einer globalisierten/durchkolonialisierten Welt (bei der Analyse verschobenen Wunschbildern gibt es ja eine gewisse Wiener Tradition). „Exot“ „exotische Praramilitärs“, „I.N.C.H: I never come home (again)“, das von Mas erwähnte „Moment der Freiheit“, nichts mit Politik und Diskursen zutun haben zu wollen usf. Eine Suche nach dem „Heart of Darkness“ nicht mehr am absoluten Rande der Zivilisation – die von Joseph Conrad in den kongolesischen Urwald geschriebene absolute Unordnung und Sinnlosigkeit mitsamt einem archaischen Patriarchen –, sondern um die leere Mitte der Gesellschaft. (Das Wahnwitzige an unserer Gesellschaft ist ja, dass dieses drohende Andere den abgeholzten Urwald verlassen hat und in unserer Mitte angekommen ist: nicht nur in der bekannten Form paranoischer, irrwitziger Führerpatriarchaten, sondern eines Urwaldvirus, das die intimsten Beziehungen besetzt hat.) Mein Eindruck also: Die Prepper-Szene folgt nach wie vor dem Imaginären des Kolonialismus und des Imperialismus, geographisch nach Hause geholt und umgeleitet durch reaktionäre Blockbuster-Bunker-Vorstellungen, die sich im Kalten Krieg entwickelt haben. Zwei Bemerkungen noch zum Schluss: Diese Vorstellungen unterscheiden sich doch sehr, sehr deutlich von den Ansätzen des zivilen Ungehorsams und der Wildniserfahrung eines Thoureau. Und m.E. stellt sich vielleicht weniger die Frage, welche Staatsideologien Prepper vertreten oder verwerfen (sie sehen sich an der Grenze im vorgestellten Ausnahmezustand und am Tag X), sondern, sozialstaatlich gedacht, inwiefern eine stabile emotionale Entwicklungsbasis für ihre Kinder gegeben ist, die ja gewöhnlich die Hauptopfer der Wunschvorstellungen ihrer Väter sind.
Vielen Dank für die Lektüre + freundliche Grüße
Herrschaft ist Herrschaft, Herr Zolles, es gibt keine gute Herrschaft. Es bringt daher auch nichts, zu versuchen sich mit Freud herauszuretten. Auch wenn das das Mitte-Milieu, Mitte-Rechts, Mitte-Links, nicht versteht: Sie scheitern am selben wie die Rechtsnationalen, an Selbstidentität und Andersheit. Das ist auch nicht erstaunlich in den heutigen Global-Zeiten und vielleicht ist auch deswegen für euch die Zeit knapp, aber das ist halt trotzdem trivial. Und Hass und Hetze kann man übrigens auch in besonders gebildeten Worten verbreiten, es bleibt aber trotzdem Hass und Hetze, die Wirkungs- und Tiefenwirkungszeit ist einfach eine andere. Ansonsten versucht es doch an den privatisierten Universitäten und den privatisierten Lehrstühlen mit ihren privaten Ethikkommissionen auch mal mit Psychopharmaka – wenn Sie schon Freud erwähnen. Mit euch Normalos und Normalas, egal welche westliche Ideologie ihr vertritt, ist es immer dasselbe: am Ende braucht ihr immer mindestens einen, den ihr in die Pfanne hauen könnt.
Herr (nehme ich doch stark an) Mas, Ihre Aussage ist angekommen; leider baut sie auf zahlreichen Fehlschlüssen hinsichtlich meines Kommentars (beginnend damit, dass ich nicht behauptet habe, dass es gute Herrschaft gibt; btw: gibt es Mündigkeit?) und Vorurteilen hinsichtlich meiner Person auf, sodass mir Zeit und Geduld fehlt, diesen Diskurs, von dem Sie sich ohnehin nur angegriffen fühlen, weiterzuführen.
@Zolles: Ihr Einwand mit den Vorurteilen und den Fehlschlüssen wäre am ehesten dann korrekt, wenn Sie sich selber diesen Vorwurf zuerst gemacht hätten. Denn dann hätte ich nicht auf Ihren Kommentar antworten müssen, was mir lieber gewesen wäre. Es ist allgemein bekannt, dass Sprache und Kommunikation immer wieder Glücksache sind. Ganz besondern gilt das für Forendiskussionen oder andere Kanäle im Internet. Wenn dann der Primärtext einer solchen Forendiskussion qualitativ ungenügend ist, ist die ganze sich daran anschliessende Diskussion zumindest sehr schwierig wenn nicht bereits zum Scheitern verurteilt. Und wenn ein öffentlicher Text, wenn auch unbeabsichtigt, Vorurteile gegen Minderheiten bedient, ist es legitim, den Text und den Autoren dafür (auch hart) zu kritisieren. Ich denke, das muss man nicht erklären. Alles Gute wünsche ich Ihnen, Ihren Wiener Kollegen und dem Autoren des Ausgangstextes trotzdem.
Tho-Mas, Christ-Mas, Mas-ke oder Mas auch immer – decken Sie doch mal Ihre Identität auf. Nicht weil mich Ihr Name interessiert, aber es zeigt sich, unabhängig von der Qualität der „Primärtexte“, dass das Niveau der Foren-Beiträge steigt, wenn sich die Teilnehmer nicht hinter einem Pseudonym (oder nom de guerre) verstecken und aus ihrer uneinsehbaren Hecke stumpfe Lanzen gegen Don Quijot’sche Feinde abfeuern.
Ich kann mit diesem Artikel hier – wie mit den meisten auf dieser Seite – nichts anfangen! Offenbar wissen die Leute vor lauter Langeweile nicht, was sie machen sollen – also muss ständig ein neuer Kick her. Wer käme, wenn er seine fünf Sinne zusammenhat, auf den Gedanken, für einen möglichen Krisenfall Vorräte anzulegen? Wer käme auf den Gedanken, darüber ein Forschungsprojekt aufzuziehen? Man merkt, dass sich die Geisteswissenschaften nur noch mit sich selbst beschäftigen. Damit ihnen schlusseindlich die „Forschungsprojekte“ nicht ausgehen, werden immer absurdere Themen gesucht, die noch beackert werden können. Hauptsache, es ist weit genug von der Alltagsrealität entfernt! Dass wir wohl noch immer in einer Überflussgesellschaft leben, zeigt auch dieser Überfluss an unproduktivem Gedankengut. Es ist gut, dass ich mir das nicht antun muss!
Irgendwie komische Umgangsformen in diesem Forum, aber das wäre mal ein anderes Thema….
Zur Sache zwei Anmerkungen:
1. Prepping und Rationalität
Die Rationalität des Prepping ergibt sich m.E. aus einem mangelnden Systemvertrauen. Weil man sich auf das reibungslose Funktionieren insbesondere der Versorgungsleistungen der Gesellschaft nicht verlassen zu können meint, muss man selbst präventiv tätig werden. Das Misstrauen trifft offenbar gleichermaßen den Staat als Ordnungs- und Vorsorgeinstitution wie die marktlichen Institutionen der Konsumgesellschaft. Nicht vertrauen kann man aber offenbar auch dem unmittelbaren sozialen Umfeld jenseits der Familie, also der Nachbarschaft. Solidarität wird als eher unwahrscheinlich angenommen und vermutlich als solche auch selbst verworfen. „Be prepared“ ist immer eine individuelle Losung, die in einem Kampf aller gegen alle ihren Ort hat.
Tatsächlich hat dieses Misstrauen einen rationalen Kern, der sich während der Corona-Krise zum Teil gezeigt hat. Der Staat ist auf bestimmte Ausnahmesituationen ‑zwangsläufig – nur bedingt vorbereitet. Auch das jeweilige nationale Staatsverständnis hier spielt eine Rolle. Die kapitalistische Konsumindustrie kann defacto an Grenzen kommen – wobei dies während Corona nicht wirklich bis in harte Extreme getestet wurde. Und Solidarität ist unter Umständen eine eher knappe Ressource.
Wer Prepper für „irre“ hält, muss sich zumindest eingestehen, dass diese Pathologisierung ihrerseits eine bestimmte psychische Funktion im eigenen Identitätsmanagement spielt: Weil wir alle ziemlich aus dem psychischen Leim gingen, wenn wir die Anästhesien aufhöben, die den extremen Voraussetzungsreichtum und die Fragilität vieler zivilisatorischer Leistungen verdrängen helfen, die wir im Alltag leichtfertig einfach so als vorhanden einkalkulieren. Das ist ein bisschen so wie beim Autofahren: Machte man sich auf der Autobahn bei Tempo 140 mitten im dichten Überholverkehr für einen längeren Moment klar, welchen Kräften und Gefahren wir uns da eigentlich gerade aussetzen – es wäre wohl schwierig, die Fahrt weiter fortzusetzen. Insoweit gilt für unsere zivilisatorischen Umwelten genau das, was seit McLuhan für alle Medien gilt: Sie werden erkauft und sind eigentlich nur erträglich, indem wir unsere Wahrnehmung in Teilen anästhesieren. Prepper steigen in gewisser Weise aus, indem sie einen aufwendigen Plan B mitführen.
Interessant wird es meines Erachtens, wenn man sich fragt, woraus dieses Systemmisstrauen (in Normalzeiten) jeweils gespeist wird, welche individuellen und systemischen Erfahrungen ihnen zugrundeliegen, damit man sich entschließt, den geltenden Normalitätsbehauptungen und ihren Praktiken tatsächlich einen alternativen Handlungsentwurf entgegenzusetzen. Auf jeden Fall scheint das Preppen unterschiedliche Stoßrichtungen und Radikalitäten zu kennen und in ganz unterschiedlichen ideologischen & körperbaulichen Rahmungen einen Platz zu finden. (Nebenbei: Corona offenbarte typisch nationale Preppercharakteristiken: Deutsche preppen anal (Klopapier), Franzosen oral (Wein), Amis lethal (Waffen & Munition)…)
Auffällig ist die zentrale Rolle der Disziplin, mit der Chaos, Kontrollverluste etc. bewältigt werden soll. Von da aus geht es dann schnell in Richtung Militarisierung und zu dem durch Theweleit bekannten „soldatischen Mann“ und dessen Ängsten und Reaktionsbildungen. Man muss freilich nicht bekennender Faschist sein, um Fragmentierungsängste zu haben und auf diese Weise dagegen vorzugehen, Latenz genügt. Allerdings gilt: Preppen ist immer prä-reaktiv, sprich strukturell reaktionär. Die Energien fließen ins Vorwegnehmen der Katastrophe, nicht etwa in politische Arbeit, die Verhältnisse lebbarer zu machen und vielen Katastrophenszenarien so ihre Grundlage zu entziehen.
2. Prepping und die Mitte der Gesellschaft
Wenn man sich aktuelle Ordnungswiederherstellungsapologeten ansieht, so formieren sich daraus gesellschaftliche Bewegungen, die sich selbst durchaus in der Mitte der Gesellschaft sehen und ihr soziologisch gesehen auch entstammen. Angst vor Unordnung ist kein Unterschichtsphänomen. Offenbar ist es in der „Mitte der Gesellschaft“ viel wahrscheinlicher, weil gerade diese Mitte weiß, was sie zu verlieren hat und wie prekär ihre Lage rasch werden kann. Vermutlich weiß sie auch, wie brutal man oft vorgehen muss, um zu mittlerem Wohlstand zu gelangen bzw. ihn zu halten. Und weil man „näher dran“ ist, an den Bedingungen des Aufstiegskampf und der Positionsverteidigung (näher = ohne umfangreiche Rücklagen), sowohl schwächere als auch stärkere Positionen und die dazwischen liegenden Wege kennt, dürfte die damit verbundene Empathie auch erahnen lassen, wie schnell erreichte Positionen kippen können. (Vor allem schon länger) vermögende Schichten haben dieses Problem wohl weniger: Sie verfügen über so starke Ressourcen und Bewegungsräume, dass sie sich insoweit sicherer fühlen, als dass sie ihren Macht- und Behauptungsmitteln stärker vertrauen. Wie realistisch oder imaginär dies tatsächlich ist, sei hier einmal dahingestellt.
Auf jeden Fall kann man daher m.E. nicht sagen, dass das Preppen in der Mitte der Gesellschaft angekommen sei – es gehört wohl primär genau schon immer zu dieser Mitte.
Wie Julian Genner richtig schreibt, hat die apokalyptische Auflösung von Ordnung für viele jedoch auch sehr attraktive Züge. Filme und Spiele bieten damit Räume des phantasierenden Probehandelns an, die diffuse Ängste vor Ordnungsverlust in pragmatische Verhaltensformen bzw. Copingstrategien überführen können. Sie zeigen zugleich auch, wie anstrengend es für viele von uns offenbar ist, den Zumutungen komplexer Ordnungen und den damit verbundenen Affektdämpfungen umzugehen. Das braucht viel Sublimationsarbeit, Rücksichtnahme, Selbstzügelung, während wir andererseits ständig und systematisch mit aggressiven Energien aufgepumpt werden, die Dominanz, Durchsetzungsfähigkeit, Affektsteigerung durch konsumtive Erlebnisverdichtung etc. propagieren und anreizen. Insofern wäre m.E. das Prepperphänomen noch viel breiter zu fassen. Worin z.B. liegt die immer weiter um sich greifende Lust am SUV, wenn nicht in einem diffusen Bedürfnis, „vorbereitet“ zu sein: auf die Notwendigkeit bzw. das latente Bedürfnis, unsere zivil(isatorisch)en Pfade zu verlassen, und jederzeit in der Lage zu sein hinwegzufahren über alles, was sich einem so ständig in den Weg stellt: andere Verkehrsteilnehmer, Tiere, Natur, Landschaft, Klima etc.. In dieser Hinsicht sind SUVs nichts anderes als hochsublimierte Formen von Mord- und Zerstörungsphantasien, verbunden freilich mit dem Luxus-Versprechen, weder selbst Schaden zu nehmen noch dafür belangt werden zu können. Autoritäres und zugleich dromokratisches Selbstverständnis: brav unterworfen, gearbeitet und Geld verdient, gehorsam ins Auto (und die eigene Volks(körper)wirtschaft investiert, ermächtigt zum kompensativen Ausleben der dafür unterdrückten Selbstbestimmungswünsche, quasi durch technisch zugewachsenen „Sachzwang“ legitimiert, dass der Langsamere und Kleinere dem Schnelleren und Größeren „naturgemäß“ zu weichen habe, selbst nur den Fortschritt exekutierend…