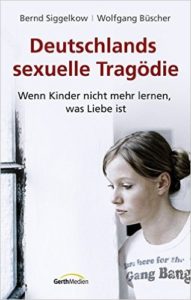
Pornographie lässt sich im Internet anonym, kostenfrei und ohne Zugangsbeschränkung konsumieren. Einschlägige Inhalte erreichen mühelos jugendliche Bevölkerungsgruppen, die früher gesetzlich besser geschützt waren. Wohl deshalb geistern immer wieder dramatische Diagnosen durch die Massenmedien: „Deutschlands sexuelle Tragödie“ oder „Pornographie als Leitkultur der Unterschicht“.
Was hat es mit diesen Befunden auf sich? Zunächst projizieren sie problematisches Sexualverhalten auf Pornographie und verkennen dabei eine von sexuellen Anspielungen strotzdende Konsumkultur. Ausserdem nehmen sie oft bedenkliche sozialstrukturelle Zuschreibungen vor: Das Bürgertum konsumiere erotische Kunst, die Unterschicht pornographische Schmuddelware. Das Hauptaugenmerk aber gilt einer scheinbar verwahrlosten Jugend. All diese Dramatisierungen blenden schlichte Tatsachen aus: Pornographie wird schichtunabhängig konsumiert und ist in erster Linie ein Produkt von Erwachsenen für Erwachsene.
In diesem Beitrag resümiere ich den Stand der Wirkungs- und Nutzungsforschung und gebe anschliessend einen Ausblick, wie Jugendliche mit Blick auf ihren Pornographiekonsum begleitet werden können.
Die Debatte über Pornographie wird von einer lange tradierten Jugendfeindlichkeit bestimmt.
Wie lebt die Jugend ihre Sexualität heute aus? Nun, die Jugend gibt es nicht, ebenso wenig eine Generation Porno. Sie sind genauso Vereinfachungen, wie es die Generation Praktikum oder Generation Golf einst waren. Selbst empirische Studien wie die Jugenduntersuchungen zu Liebe, Partnerschaft und Sexualität der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind kein Abbild der Wirklichkeit. Trotzdem bietet die Datenflut einen guten Einblick, vor allem in Langzeittrends. Und die Ergebnisse widersprechen einer sexuellen Tragödie diametral: eine Mehrheit der Jugendlichen übernimmt partnerschaftliche Verantwortung für die Verhütung, 92% der Heranwachsenden verhüten schon beim ersten Mal. Die Beziehungen sind romantisch und durch Ideale wie Liebe und Treue geprägt. Es gibt eine hohe Beziehungsdichte und serielle monogame Beziehungsmuster (Heßling & Bode 2015).
Treue und Liebe: Barbie und Ken (©Nicole Castanheira, Flickr)
Die Medienwirkungsforschung verführt mit einfachen Kausalitäten
Diese unaufgeregten Einsichten sollen nicht verschweigen, dass an den gesellschaftlichen Rändern ein möglicherweise fragwürdiges Sexualverhalten anzutreffen ist, das durch die Durchschnittswerte verwischt wird. Um dies zu beurteilen, bedarf es allerdings einer umfassenden gesamtgesellschaftlichen Betrachtung. Die mediale Berichterstattung hingegen greift immer wieder auf Theorien bzw. Theoriefragmente der Medienwirkungsforschung zurück, um möglichst einfache Zusammenhänge zu suggerieren (vgl. Hill 2011). Zu den prominentesten gehören:
- Die sozial-kognitive Lerntheorie behauptet, dass in Pornos dargestellte Verhaltensweisen zur Nachahmung einladen. Dieser Theorie zufolge führen positive Gefühle beim Betrachten zur Erwartung, ähnliche Gefühle bei der Selbstausführung der dargestellten Praktiken zu empfinden. Da negative Gefühle (Langeweile, Ärger etc.) beim Pornographiekonsum nicht durchlebt werden, erhöht sich wiederum die Wahrscheinlichkeit, das Gesehene in die Realität umzusetzen.
- Die Theorie der Exemplifikation fokussiert auf pornographische Darstellungen, die als normale, gesellschaftlich verbreitete Verhaltensweisen angenommen werden. Das Dargestellte wird als Norm (miss-)verstanden.
- Die Theorie des sozialen Vergleichs stellt die Unzufriedenheit mit seinem Körper und seinen sexuellen Fähigkeiten – auch denen der Partner*in – in Vordergrund. Sie sei das Resultat eines Vergleichs mit der Phantasiewelt des Pornos, die von jungen, attraktiven, immer willigen, gut bestückten und ausdauernden Darsteller*innen bevölkert ist.
- Und schließlich geht die Habitualisierungs- und Desensitivierungs-Theorie davon aus, dass ein ursprünglich hoher Erregungsgrad bei dauerhaftem Pornographiekonsum abnimmt und ein stärkerer Reiz nötig wird, um das bekannte Erregungsniveau wieder zu erreichen.
Die Befunde bleiben bescheiden – auch, weil es in diesem Feld strafrechtliche Grenzen, vor allem aber forschungsethische Vorbehalte gibt: Wie lässt sich etwa der Beweis für die Hypothese erbringen, wonach der Konsum gewalthaltiger Pornographie zu gewalttätiger Sexualität führe? Selbst Erwachsene wurden im Labor bislang nur mit kleinen Dosen sexuell expliziter Gewaltdarstellungen konfrontiert. In den Ergebnissen finden sich daher statt Kausalitäten Korrelationen, die mehr Fragen aufwerfen, als Antworten geben.
Bringen Störche Kinder? In mehreren europäischen Ländern korreliert die Geburtenrate mit der Storchenpopulation. Je weniger Störche, umso weniger Kinder. Das gleichzeitige Auftreten zweier Phänomene bedeutet aber nicht, dass sie in einem kausalen Zusammenhang stehen. Und wenn, wäre auch folgende Hypothese zulässig: Kinder bringen Störche.
Eigenartig an der Medienwirkungsforschung ist ausserdem, dass sie immer dann in der öffentlichen Debatte mitzumischen scheint, wenn ’schädliche‘ Korrelationen à la more porn, more violence Hochkonjunktur haben. Diese Forschungsrichtung scheint für die Rolle der Kassandra abonniert zu sein. Merkwürdig daran ist letztlich, dass wer nach Korrelationen in Richtung more porn, more freedom sucht, ebenso fündig wird:
„Das Ausmaß von Pornographiekonsum korreliert mit sexuell freizügigeren, permissiveren Einstellungen [zu] vor- und außerehelichem Sex, ‚casual sex‘ und Verhaltensweisen. Dies kann auch als ‚positive Wirkung‘ von Pornographie gewertet werden, im Sinne einer Erweiterung des sexuellen Spektrums, einer Befreiung von tradierten Vorstellungen von ’normalem‘ und ‚pathologischem‘ Sex, evtl. auch zur früheren Klärung und Festigung der eigenen sexuellen Orientierung, Identität und Vorlieben.“ (Hill 2011, S. 391)

Die Nutzungsforschung verspricht differenzierte Einblicke
Die Perspektive wechselt Feona Attwood (2005). Sie schlägt vor, nicht mehr danach zu fragen, was die Medien mit den Menschen, sondern, was die Menschen mit den Medien machen. In ihren Forschungen stehen daher Nutzungen und Erfahrungen der Konsument*innen mit Pornographie im Vordergrund.
Eine deutsche Untersuchung, die 160 Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren qualitativ befragt hat, folgt dem oben beschriebenen Perspektivenwechsel und fragt: „What do boys do with porn?“ (Matthiesen & Schmidt 2011) sowie „What do girls do with porn?” (Matthiesen et al. 2011). Die wichtigsten Ergebnisse zeigen: 96 Prozent aller Jugendlichen nutzen das Internet, und fast alle sind mit Pornos vertraut. Dabei besteht ein großer Geschlechterunterschied: Jungen konsumieren entsprechende Inhalte deutlich mehr als Mädchen.
Der Konsum lässt beim Eingehen fester Partnerschaften nach. Die Jungen verlassen sich beim Onanieren mehr auf die Erinnerungen eigener Erfahrungen und empfinden weniger Langeweile, die sie mit Pornograpie vertreiben. Mädchen konsumieren vorwiegend, um sich sexuell kompetent zu fühlen, schätzen den Informationsgewinn jedoch eher niedrig ein.
Zwar ist das Interesse an Pornographie massiv gegendert, da Jungen Pornographie früher sehen und häufiger zur Masturbation nutzen. Die hohe Verfügbarkeit von Pornographie führe aber zu ihrer Normalisierung, nicht zu Verrohung und Verwahrlosung. Zudem erkennen und wahren Jugendliche die Grenze zwischen Fiktion und Realität. Der Umgang der allermeisten Jugendlichen mit Pornos, so konstatieren die Autor* innen, ist ein souveräner Ausdruck gesellschaftlicher Zivilisierung.
Angesichts dieser Ergebnisse liegt der Verdacht nahe, dass die dramatischen, aber weitgehend unbewiesenen Annahmen der Medienwirkungsforschung nicht viel mehr als das Bedürfnis der Massenmedien nach Panikmoral befriedigen. Trotzdem darf der erhebliche Forschungsbedarf nicht übersehen werden, liegt doch vieles über den Einfluss der Pornographie noch im Dunkeln. Dazu gehören die möglicherweise positiven Aspekte des Pornographiekonsums sowie die zunehmende Diversifizierung. Neben der als Mainstream-Pornographie titulierten Strömung haben sich mit FemPorn (vgl. den Beitrag von Oliwia Blender), Queer Porn und Amateur-Pornographie (Realcore) neue Richtungen herausgebildet, die ihrerseits sehr ausdifferenziert sind.
Ken goes queer (©trash world, Flickr)
Notwendige Forschunglücke? Der Einfluss der Pornographie auf die psychosexuelle Entwicklung von Jugendlichen
Niemand weiss, welchen Einfluss Pornographie auf die psychosexuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen hat. Auch künftig dürfte es schwer sein, hierüber allgemeine Aussagen zu machen. Schliesslich gibt es, wie erwähnt, nicht die Pornographie und auch nicht die/den Jugendlichen, sondern ganz unterschiedliche Nutzungsmotive und Gelegenheiten, bei denen junge Menschen auf unterschiedliche Inhalte in Pornotopia stoßen – Inhalte überdies, die verschiedene Gefühle auslösen (können). Ausserdem finden verschiedene soziale Settings kaum Berücksichtigung. So erhält Pornographie eine völlig andere Funktion, wenn sie im Kreis von Freunden statt alleine konsumiert wird. Im letzteren Fall stehen Kenntnisreichtum und Wagemut, auch schwierige, verstörende Dinge aushalten zu können, im Vordergrund. Zugleich ermöglicht es die Gruppe, die individuellen Ängste zur Sprache zu bringen und zu bewältigen – auch und gerade in Abgrenzung zur Welt der Erwachsenen.
„Warum darf ich mit 14 Jahren Geschlechtsverkehr haben, aber mir diesen erst mit 18 Jahren ansehen?“
Diese Frage eines Schülers der 6. Klasse brachte mich vor ein paar Jahren ins Schwitzen. Hinter dem Unverständnis des Schülers erkannte ich aber zugleich eine Neugier nach möglichst anschaulichen Informationen rund um die Sexualität. Diesem Informationsbedürfnis steht gegenwärtig der sexualstrafrechtliche Schutz vor Gefährdungen entgegen. Doch die in dieser Lebensphase typischen Suchbewegungen führen dazu, dass die Konfrontation mit Pornographie nahezu unvermeidlich ist. Technische Einschränkungen wie Filterprogramme wirken wenig abschreckend, eher herausfordernd, die Informationssperre zu umgehen.
Daraus darf nicht auf die Sinnlosigkeit solcher Maßnahmen geschlossen werden. Im Gegenteil: Eltern zeigen mit solchen Lösungen eine Haltung, die den Kindern und Jugendlichen verdeutlichen soll, dass diese Inhalte für Erwachsene vorgesehen sind. Technische Lösungen sollten jedoch nicht das persönliche Gespräch resp. die Gesprächsbereitschaft ersetzen.
Ich-Botschaften formulieren!
Mit Jugendlichen über Pornographie zu sprechen, ist für viele Erwachsene mit Gefühlen der Scham und Peinlichkeit verbunden – für Eltern deutlich mehr als für (sexual-)pädagogische Fachkräfte. Als Eltern sollte man sich absprechen, ob und wenn ja, wer das Gespräch suchen sollte. Grundsätzlich bietet sich ein gleichgeschlechtliches Gegenüber an. Andererseits zeigen Untersuchungen, dass derartige Themen nicht gerne mit den Eltern besprochen, sondern lieber in der peer group verhandelt werden.
Hilfreich ist, wenn eigene Verstrickungen mit dem Thema bewusst sind, und die grundlegende Gesprächsregel Beachtung findet, Ich-Botschaften zu formlieren. Auf diese Weise können Eltern eigene Gedanken und Bedenken in Worte fassen, ohne eine gesellschaftliche Norm zu pauschalisieren, die es schlicht nicht gibt. Die Botschaft „Ich denke, dass der Pornographiekonsum auch gefahrvolle Seiten haben kann“ ist ehrlicher und wahrheitsgetreuer formuliert als „Pornographiekonsum ist auf jeden Fall gefährlich, die Konsumenten sind krank!“.
Zudem sollte die Schule immer mehr zum Ort werden, wo fächerübergreifend Medienkompetenz auch mit Blick auf schwierige Inhalte gelehrt wird. Das fordert etwa die Medienpsychologin Nicola Döring, die sich für die Vermittlung einer Pornographie-Kompetenz ausspricht. Etwas moderater erwartet die Erziehungswissenschaftlerin Alexandra Klein von der Schule eine mehrdimensionale Thematisierung von Sexualität. Beide Forderungen würden das Angebot erweitern, junge Menschen in ihrer Neugier, die Welt der Erwachsenen kennen zu lernen, nicht allein zu lassen.
Literatur
Heßling, Angelika; Bode, Heidrun. 2015. Jugendsexualität 2015. Die Perspektive der 14- bis 25-Jährigen. Ergebnisse einer aktuellen Repräsentativen Wiederholungsbefragung. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
Hill, Andreas. 2011. „Pornografiekonsum bei Jugendlichen – Ein Überblick über die empirische Wirkungsforschung“. Zeitschrift für Sexualforschung 4.
Matthiesen, Sila; Martyniuk, Urszula; Dekker, Arne. 2011. „What do girls do with porn?“. Zeitschrift für Sexualforschung 4.
Matthiesen, Silja; Schmidt, Gunter. 2011. „What do boys do with porn?“. Zeitschrift für Sexualforschung 4.
Bildnachweis
Titelbild von Blake Kathryn.
uncode-placeholder
Jörg Nitschke
Jörg Nitschke hat Soziale Arbeit, Erziehungswissenschaften und Sozialmanagement in Emden, Berlin, Osnabrück und Münster studiert. Darauf folgten Weiterbildungen in Sexualpädagogik sowie Paar- und Sexualberatung. Seit 2006 ist er Dozent des Instituts für Sexualpädagogik in Dortmund und dort Vorstandsmitglied seit 2014. Aktuelle Publikation: Beate Martin/Jörg Nitschke: Sexuelle Bildung in der Schule, Stuttgart 2017.




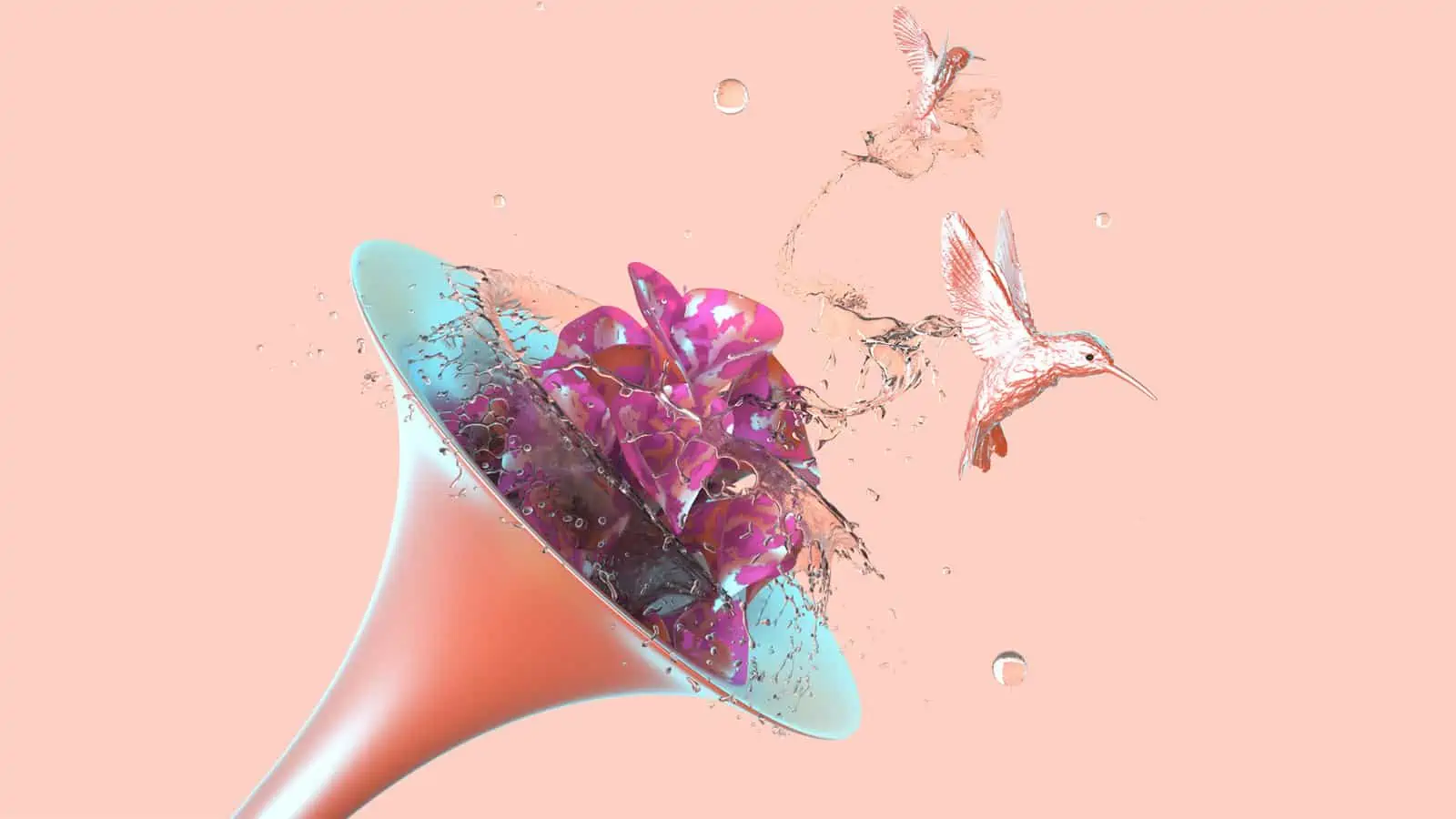



Lieber Herr Nitschke,
vielen Dank für diese interessanten Einsichten. Mit Blick auf den Pornokonsum Jugendlicher hat sich mir aber doch eine Frage aufgedrängt. Hin und wieder gewinne ich den Eindruck, die Jugendlichen von heute konsumieren Pornografie wie Redbulls. Sobald der Körper etwas abschlafft, wird Koffein nachgeschüttet. Sobald sich kleine Frustrationen in der Schule oder der Arbeit einstellen, führt man diese über porno-assistierte Masturbation möglichst rasch ab. Der Hochleistungssex auf dem Touchscreen korrepondiert meiner Meinung nach gut mit den Leistungsansprüchen an jungen Menschen. Gibt es dazu Untersuchungen? Würde mich sehr interessieren.
Lieber Herr Wolf, Masturbation als Stressreduktion in Verhältnissen einer sich zunehmend selbst herausfordernden meritocracy – das wäre ja auch als individueller gesundheitspräventiver Beitrag zu verstehen. Grimm et al (2010) konstatieren, dass bei Jungen ein gewisser Triebdruck und „Notgeilheit“ zum Pornokonsum führe, was Schmidt/Matthiessen (2011) als „schlichte, triebenergetische Vorstellung männlicher Sexualität“ bezeichnen. In ihrer Untersuchung war Langeweile und der Wunsch, diese zu vertreiben, das häufigste Motiv für den Konsum von Pornographie. Viele Jugendliche geben eine Verweildauer von wenigen Minuten an, was Ihre Hypothese stützen könnte. Zur Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen allgemein gibt es jährliche Erhebungen des Medienpädagagogischen Forschungsverbundes Südwest (mpfs), aktuell JIM-Studie/KIM-Studie (2016): https://www.mpfs.de/startseite/
Danke für den Hinweis! Tatsächlich sehr normativ formuliert, die Redaktion wird darauf reagieren.
Die umfangreiche internationale Forschung zur Wirkung des Pornografiekonsums ergibt ein deutlich anderes Bild als die hier wiedergegebene Position und Argumentation der Hamburger Schule (Matthiesen & Schmidt). Es ist zwar richtig, dass experimentelle Studien (die (multi-)kausale Schlüsse zulassen) aus ethischen und rechtlichen Gründen an Jugendlichen nicht durchführbar sind, jedoch zeigen zahlreiche Längsschnittstudien zuverlässig die Veränderung von Einstellungen und Verhalten bei Jugendlichen mit häufigem Pornografiekonsum. Regressionsanalysen und experimentelle Studien zeigen, dass sich selbst bei Erwachsenen Präferenzen hin zu devianten und zunehmend gewalthaltigen Inhalten verändern, die Toleranz für sexuelle Gewalt zunimmt und die sexuelle Zufriedenheit und Empathiefähigkeit in der Partnerschaft abnimmt. Beispielhaft genannt sei hier eine Meta-Analyse von 46 Studien mit 12.323 erwachsenen Probanden (Oddone-Paolucci et al. 2000), die feststellt, dass der Konsum von (einfacher) Pornografie folgende Effekte hatte: Einen Anstieg der Neigung zu devianter bzw. harter Sexualität (Gewalt, SM, Pädophilie u. a.) (Anstieg um 31 %), zu sexueller Gewalt (22 %), an negativen Einstellungen zu intimen Paarbeziehungen, d. h. festen Bindungen (20 %) und der Akzeptanz von Vergewaltigungsmythen (31 %), d. h. der Überzeugung, Frauen wollten letztlich zum Sex gezwungen werden oder würden eine Vergewaltigung am Ende doch genießen.
Wenn selbst bei Erwachsenen wiederholter Pornografiekonsum zu einer signifikanten Veränderung von Einstellungen und sexuellem Verhalten und zu einer Verschiebung der Präferenzen hin zu härteren und gewalthaltigen Inhalten führt, ist zu erwarten, dass dies erst recht für Jugendliche gilt, die noch sehr viel stärker beeinflussbar sind und kaum über eigene sexuelle Erfahrungen als relativierende Referenzgröße verfügen.
Peter und Valkenburg (2016) fassten die Ergebnisse von Studien (peer reviewed) zum Pornografiekonsum von Jugendlichen in den letzten 20 Jahren zusammen (1995–2015): Der Pornografiekonsum Jugendlicher war mit einer permissiveren, instrumentellen Haltung zu Sexualität verknüpft, d. h. der Trennung von Sexualität und Beziehung, entsprechend mit früherem Geschlechtsverkehr und häufigerem Gelegenheitssex sowie mit stärkeren genderstereotypen Überzeugungen bezüglich Sexualität. Jungen, die häufiger Pornografie konsumieren, neigen zu mehr sexueller Aggression und werden häufiger Täter von sexuellem Missbrauch oder anderen Formen sexueller Gewalt. Mädchen, die Pornografie konsumieren, werden häufiger Opfer von sexueller Gewalt. Mädchen fühlen sich durch Pornografie stark unter Druck gesetzt, den dort vermittelten Schönheitsnormen und Sexnormen zu entsprechen.
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt eine aktuelle europäische Studie von 2016, durchgeführt in fünf europäischen Ländern mit 4.564 Probanden im Alter von 14 bis 17 Jahren (Stanley et al. 2016). Diese stellte einen signifikanten Zusammenhang zwischen einem regelmäßigen Konsum von Online-Pornografie durch männliche Jugendliche und dem Ausüben von sexuellem Missbrauch sowie von sexueller Gewalt in intimen Beziehungen fest. Häufiger Konsum erhöht bei Jungen zudem die Wahrscheinlichkeit eines negativen Frauenbildes und des vermehrten Sendens sexueller Botschaften und Bilder (Sexting).
In unserer Arbeit mit Betroffenen und Angehörigen, deren Partnerschaft an den Folgen von exzessivem oder süchtigem Pornokonsum zerbricht, erleben wir, wie stark pornografisch geprägte Einstellungen und Erwartungen in die Realität von Beziehungen eindringen. Auch in der Präventionsarbeit in Schulen erleben wir, wie sehr Pornostandards die Beziehungen Jugendlicher bzw. zunächst ihre Wunschliste prägen und wie viele Mädchen unter Druck stehen, pornonormierte Erwartungen selbst dann zu erfüllen, wenn sie diese als eklig, demütigend oder schmerzhaft empfinden, weil „das doch normal ist“ und sie befürchten, als frigide, verklemmt und von gestern zu gelten, wenn sie z.B. Analsex oder SM-Praktiken ablehnen: „Wenn wir das nicht mitmachen, sind wir doch selbst schuld, wenn er sich ne andere sucht“. Ist das progressiv, aufgeklärt und selbstbestimmt?
Eine ausführliche Zusammenfassung von Studien und Wirkfaktoren findet sich in „Fit for Love? Praxisbuch zur Prävention von Internet-Pornografiekonsum“ (www.fit-for-love.org) oder ein Auszug (Studien) unter http://www.tabea-freitag.de/fileadmin/tabea–freitag/pdf/Fit4Love_IV.pdf.
Liebe Frau Freitag, jetzt haben wir erneut nur im digitalen Orbit miteinander Kontakt. Herzlichen Dank für Ihren Kommentar, der mich jetzt aber so kurz vor Redaktionsschluss ein wenig kalt erwischt. Bei uns wirken ja offensichtlich unterschiedliche Paradigmen, und das ist völlig in Ordnung so, denn ich wertschätze Ihre Beratungsarbeit und habe gleichfalls an keiner Stelle behauptet, dass es nicht auch problematischen Konsum von Pornographie geben könnte.
Trotzdem braucht es ein wenig Gegenrede: „Es ist zwar richtig, dass experimentelle Studien (die (multi-)kausale Schlüsse zulassen) aus ethischen und rechtlichen Gründen an Jugendlichen nicht durchführbar sind“ schreiben Sie, aber die Forschungsethik macht doch nicht bei den Erwachsenen halt! Ist es nicht eher so, dass Menschen, die gewaltvolle Fantasien oder bestimmte Präferenzen haben, eben auch derartige pornografische Inhalte konsumieren? Henne oder Ei? Was war zuerst da? Dies wird besonders deutlich, wenn Sie sogar Pädophilie als Beispiel führen. Dies ist unseriös, da es sich bei Pädophilie um eine sexuelle Präferenz handelt (das wissen Sie natürlich und führen es trotzdem an) und wir bis heute nicht sicher sagen können, wie eine solche entsteht. Sicher nicht auschließlich über Konsum von Medien mit sexuellen Inhalten. Auch gibt es zahlreiche Untersuchungen, die keinen Zusammenhang zwischen Pornographiekonsum und sexueller Gewalt feststellen konnten. Zum Ende machen Sie dann ein bisschen Werbung in eigener Sache (Fit for Love), dabei sollte den Leser*innen jedoch nicht vorenthalten werden, wer dort beispielsweise das Vorwort schrieb. Dr. Jakob Pastötter vertritt seine Positionen seit Jahren in der Jungen Freiheit. Auch ein Film ist unter dem Deckmantel der „Wissenschaft“ dabei entstanden:
Im Übrigen maße ich mir natürlich auch nicht an zu wissen, was am Ende dieses „unkontrollierbaren“ Experiments herauskommst. Mein Blick darauf ist dabei aber wohl ein wenig positiver.
Herzlichst, Jörg Nitschke