Die Natur erobert die Lebensmittel zurück. In der letzten Dekade hat sich der Markt für Bio-Lebensmittel in Europa knapp verdreifacht. In Berlin kaufen 4 von 5 Menschen Bio, zumindest gelegentlich. In der Schweiz geben sie dafür 262, in Deutschland immerhin noch 106 Euros pro Jahr aus (Willer und Lernoud 2017).
Der Griff zum Bio-Label verdankt sich nicht zuletzt einer zunehmenden Sichtbarkeit von Technik in industriell produzierten Lebensmitteln. Seit 1998 gilt in Deutschland die Kennzeichnungspflicht für Zusatzstoffe. Sie hat bisher unverdächtige Lebensmittel in toxische E‑Pakete verwandelt. Kurz darauf haben Wachstumshormone, gentechnisch veränderte Pflanzen und Kunstdünger den Weg vom Acker ins Fernsehen geschafft und so die technische Seite der Landwirtschaft publik gemacht.
Heute gehört, so scheint’s, Technik dank Bio der Vergangenheit an. Diese Erfolgs- und Rückeroberungsstory der Natur beruht allerdings auf einem Trick. Und der besteht in unserer Fähigkeit, Technik zu verkennen.
Verkennung
Was heißt es, etwas zu verkennen? Pierre Bourdieu (1976) beschreibt darunter, wie der ökonomische Charakter von Geschenken zugunsten ihres symbolischen Werts zurücktritt. Damit ein Geschenk als Zeichen der Freundschaft funktioniert, darf sein ökonomischer Wert nicht explizit werden. Ein vergessenes Preisschild ruiniert die Symbolik, ein vergessener Aktionskleber die Freundschaft.
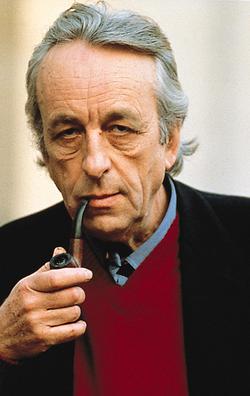
Verkennung findet, so die These dieses Beitrages, auch und gerade beim Kauf und Verzehr angeblich natürlicher Lebensmittel statt. Denn deren Natürlichkeit hat weniger mit Naturnähe, mehr mit einem kulturell eingeübten Blick zu tun, Technisches zu übersehen und zu verkennen. Bioprodukte können nur dann Symbole für Natur und Nachhaltigkeit sein, wenn wir die Technik zu ihrer Herstellung und Verbreitung ausblenden, d.h. verkennen.
Natur 2.0
Spätestens mit Anbruch des Anthropozäns hat sich die Natur verflüchtigt – zumindest jene alte Version, die für all das steht, was nicht vom Menschen gemacht ist. An ihre Stelle ist Natur 2.0 getreten. Für den Kulturphilosophen Gernot Böhme (1992: 20) sind Bio-Lebensmittel alltägliche Beispiele dafür, wie wir mit Wissen und Technik das hervorbringen, was längst verschwunden ist. Bio-Äpfel seien Zeichen für den Verlust von „Selbstverständlichkeiten in unserer Beziehung zur Natur“. Natur, so lässt sich vermuten, wird genau deshalb in Form von Bioprodukten nachgefragt, weil es sie nicht mehr gibt. Sie muss, mit anderen Worten, auf jede erdenkliche Weise neu hergestellt werden – nur nicht auf natürliche.
Kein Bio ohne Technik.
Ein erstes Indiz für den Naturverlust ist die kompensierende Betonung der ‚natürlichen Natürlichkeit von Naturprodukten‘. Darauf hat der Soziologe Niklas Luhmann (1988) schon vor dreißig Jahren hingewiesen, als er beobachtete, dass in „Läden heute naturreine Früchte angeboten“ werden. Ein zweiter Hinweis gibt Bio-Präfix. ‚Biologisch‘ mag zwar für naturnahe Anbaumethoden stehen, doch das Wort entstammt einem wissenschaftlich-technischen Kontext, der die Natur zur Biologie adelt. Drittes Indiz sind Theorievorschläge, wie die technisch hergestellte Natur zu fassen ist. Die Philosophin Nicole C. Karafyllis (2003) etwa verwendet den Begriff Biofakte – eine Verbindung von bios (griech.: Leben) und Artefakt – zur Bezeichnung von Pflanzen und Lebewesen, die nur dank Agrar- und Biotechnologien existieren können. Kein Bio ohne Technik.
Ein Bio-Apfel ist ein Biofakt par excellence. Sämtliche seiner Lebensphasen sind auf Technik angewiesen – und darauf, dass wir sie verkennen. Altertümliche Apfel-Sorten sind das Ergebnis komplexer Rück-Züchtungstechniken inklusive komplizierter Patentierungsstreits. Eine Vielzahl hochmoderner Agrartechniken sorgt auf Apfelplantagen für eine Ökologizität, die nur dank neuester Forschungserkenntnisse über das Zusammenspiel von Schädlingen und Nützlingen umzusetzen ist. Bevor der Bio-Apfel in den Supermarkt gelangt, sorgen Temperaturkontrollen, Barcodes und viel IT für die nötige Logistik. Am Ende des life cycles eines Bio-Apfels steht die Kund*in. Je höher deren Einkommen und Bildung, desto größer ihre Neigung, sich an kurzen Transportwegen und CO2-Neutralität zu orientieren (Vogelgesang 2016). Natürlich sind Naturprodukte nicht aufgrund ihrer Natur, sondern infolge technischer Verfahren – ob sie nun auf das Produkt, die Inszenierung oder die Konsumentin abzielen.
Die Tomate Sunviva besitzt eine Open Source-Lizenz. Die entsprechende Initiative will Saatgut wieder zu einem Gemeingut für alle machen (Bild: Gönninger Samen).
Zur Biofaktizität eines Bio-Apfels gehören also Agrar‑, Bio- und Züchtungstechniken genauso wie Logistik und Marketing. Gerahmt wird dieses Ensemble von einer Reihe von Selbst- und Sozialtechniken, deren sich die Konsumentin bedient, um mithilfe von Biofakten sich selbst zu einem wahlweise fitten oder leistungsfähigen, glücklichen oder schlanken Subjekt zu machen. Zu ihnen zählen Diäten und natürliche Ernährungsweisen, die trotz Bezeichnungen wie low carb, paleo oder high protein über ihren technischen Charakter hinwegtäuschen. Dazu gehören Food-Apps, die eine Vernetzung mit Gleichgesinnten, Selbstdarstellung und ‑optimierung ermöglichen. Dazu gesellen sich vermeintlich alte Kochtechniken wie das Fermentieren oder das Einmachen. Ihre symbolische Traditionalität und Naturnähe helfen modernen foodies zu verkennen, dass längst industrialisierte Techniken in der kleinen Fabrik daheim nochmals erfunden werden.
Doppelte Ambivalenz
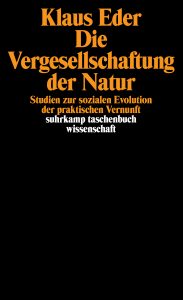
Unsere Fähigkeit, Technik zu verkennen, ist selbst eine Kulturtechnik, die wir fortwährend anpassen und verfeinern, um mit immer neuen Ambivalenzen von Natur und Technik leben zu können. Bereits unsere Haltung zur Natur ist von Widersprüchen geprägt. In der Moderne haben sich, darauf hat Klaus Eder (1988) hingewiesen, eine „theoretische Neugierde“ an Natur und parallel dazu eine „Lust an der Natur“ entwickelt. Erstere mache Natur zum Gegenstand wissenschaftlicher Erkenntnis, letztere zivilisiere, ästhetisiere und moralisiere einen nicht-instrumentellen Umgang mit ihr. Diese Ambivalenz fuße, so Eder, in alltäglichen Praktiken – „vor allem im Essen“.
Spätestens seit der Romantik trifft eine zweideutige Natur auf eine ambivalente Haltung zur Technik. Dabei wird unser Vertrauen in die Technik immer wieder von schaurig schönen Schadenserwägungen herausgefordert. Inzwischen sind wir in der (widersprüchlichen) Lage, uns über Lebensmittelskandale, industrielle Fleischproduktion und Methangasausstoß zu echauffieren, während wir blind dem appetitlichen Biofakt vertrauen, das blutig auf unserer Gabel steckt.
Was in den Gemengelagen der Ambivalenzen als naturnah durchgeht, was als technisch entfremdet gilt, darüber entscheidet auch, was zu verkennen wir imstande sind.
Gerade im kulinarischen Bereich manövrieren wir uns durch all diese Ambivalenzen durch spezifische Verkennungsleistungen, mit denen wir Zweideutigkeiten und Widersprüchlichkeiten vereindeutigen. Biokonsument*innen schlagen sich in der Küche auf die Seite eines ästhetischen und moralischen Naturverständnisses. Dabei blenden sie den Forschungsaufwand aus, der für die Rückzüchtung ihrer pro specie rara-Tomate nötig war. Sie vertrauen dem schonenden Steamer und verabscheuen die Mikrowelle, die Proteine ‚unnatürlich‘ zersetzt. Was in diesen Gemengelagen der Ambivalenzen als naturnah durchgeht, was als technisch entfremdet gilt, darüber entscheidet nicht nur, was wir zu anerkennen, sondern auch, was zu verkennen wir imstande sind.
Selbst wenn Verkennungstechniken uns in der alltäglichen Bewältigung von Ambivalenzen zur Seite stehen, hilft der zeitweise Blick hinter den Vorhang. Auf der Hinterbühne wird spätestens klar, dass Natur ohne Technik nicht zu haben ist. Auch nicht auf unserem Teller. Diese Einsicht mag helfen, selbst in Fall von Bio Technik wieder sichtbar und: debattierbar zu machen.
Literatur
Böhme, Gernot. 1992. Natürlich Natur. Über Natur im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit, Frankfurt am Main.
Bourdieu, Pierre. 1976. Entwurf einer Theorie der Praxis auf der ethnologischen Grundlage der kabylischen Gesellschaft, Frankfurt am Main.
Eder, Klaus. 1988. Die Vergesellschaftung der Natur. Studien zur sozialen Evolution der praktischen Vernunft, Frankfurt am Main.
Karafyllis, Nicole C. (Hg.). 2003. Biofakte. Versuch über den Menschen zwischen Artefakt und Lebewesen, Paderborn.
Luhmann, Niklas. 1988. Erkenntnis als Konstruktion, Bern. Online.
Vogelgesang, Jens. 2016. Foods-Trends 2016. Ergebnisse einer repräsentativen Befragung in Berlin, Hohenheim. Online.
Willer, Helga; Lernoud, Julia. 2017. Organic Farming and Market Development in Europe and the European Union. FiBL & IFOAM: Frick, Bonn. Grafik auf S. 228
uncode-placeholder
Laura Trachte
Laura Trachte hat Soziologie, Politikwissenschaft und Gender Studies in München studiert. In ihrer Doktorarbeit analysiert sie neue Konfigurationen von Natur und Technik in der Ernährung.







[…] Natur auf Kosten der Technik | Avenue: […]
Es ist klar, was gemeint ist. Dennoch klingt es so, als würde hier eine personifizierte Natur etwas erobern – dabei sind es ja Menschen, deren „Wunsch nach Natur oder Natürlichkeit“ die Märkte erobert.
Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. In philosophischer Lesart finden wir die Analyse des historisch jeweils „Selbstverständlichen“ bei Hans Blumenberg. In seinem Aufsatz „Lebenswelt und Technisierung unter Aspekten der Phänomenologie“ weist er darauf hin, dass die Natur-Technik-Abgrenzung nicht nur immer wieder Umbrüche erfahren hat, sondern dass es eine Krisenzeit der Philosophie (schließen wir hier die Soziologie mit ein) markiert, sich auf ihr jeweils auszuruhen. Von daher ist die gegenwärtige Auseinandersetzung um die Biofakte eine gute Nachricht zum Zustand oder zum analytischen Potential der Geistes- und Sozialwissenschaften der Gegenwart.
Das ist richtig. Umgekehrt bleibt aber auch richtig, dass eine Kulturkritik von Technik ohne Rückgriff auf Natur nicht zu haben ist. Ein früher Gewährsmann dafür ist Lukrez (s. den genannten Aufsatz von Blumenberg).
Genau. Empirisch lässt sich sehen, dass Natur und Technik immer als doppeltes Lottchen zusammen daherkommen. Selbst die technischste aller innovativen Technologien kommt nicht drum herum, plausibel an Natur anzuschließen: an ihren Beitrag für angepasste(re) Sorten, für mehr Nachhaltigkeit oder für das Erkunden und Befolgen von individuellen Ernährungsnaturellen. Dabei „stehen“ Natur und Technik immer wo anders, werden unterschiedlich arrangiert und artikuliert. Für den Beitrag habe ich mich auf die Seite der Technik geschlagen, um sichtbar zu machen, wo sie verkannt wird. Auch deshalb, um einer geistes- und sozialwissenschaftlich gebildeten Leserschaft zu zeigen, wo sie sich (hoffentlich) positiv ertappt fühlen kann, weil sie dazu tendiert, Natur zu sehen und Technik zu übersehen. Auch die Technik(kritik) kommt, wie Sie sagen, nicht ohne Naturbezug aus. Eine Perspektive, die alltägliche Selbstverständlichkeiten „aufdeckt“, kann helfen, Natur-Technik-Beziehungen zu debattieren und zu gestalten.
Wer kennt sie nicht, die Sehnsucht nach Natürlichkeit und Unverfälschtheit? Die Verkennungsthese klingt im Kern denn auch plausibel. Aber wie weit reicht sie und wie relevant ist sie in praktischer Hinsicht? Das muss hier nicht geklärt werden. Aber zumindest eine Andeutung wäre umso hilfreicher, als die These Bioprodukte nicht nur als Symbole für Natur in den Blick nimmt, sondern auch für Nachhaltigkeit.
In der Tat ist Verkennung hauptsächlich praktisch relevant. Sie ist eine soziale Praktik, die hilft, mit Ambivalenzen umzugehen und Komplexität zu reduzieren. Ich denke Fragen danach, wie, wo, wann und inwiefern das Technologische zugunsten von Natürlichkeit verkannt wird, sind wichtige politische Fragen. Sie erhöhen, wo nötig, die Komplexität wieder und helfen zu sehen, zu welchem Zweck und auf welches strategische Ziel hin Produktion und Konsum von Ernährung z.B. innoviert oder reguliert werden – und zu entscheiden, wo welche Technologien helfen, um z.B. nachhaltiger zu sein.
Das ist nicht unbedingt eine Frage der kategorischen Verkennung. Viele KonsumentInnen sind sich sicherlich gewisser technologischer Interventionen bewusst, aber es gibt eine GRADUELLE Abgrenzung, was noch in den Bereich des Akzeptierbaren fällt und was nicht, z.B. „Gentech Gemüse, Ok; Gentech Tiere, Nein danke“. In Anlehnung an Latour könnte man, im Bewusstsein um all die Hybriden welche unser täglich Brot ermöglichen, festhalten „We have never been natural either“.
.…ab hier ist die problematische, anthropozentrische Trennlinie zwischen Natur und Mensch/Technologie bereits fix gezogen und fungiert nur noch als Voraussetzung der weiteren Argumentation… schade! Aber auch bei anderen Avenue Artikeln ist auffällig, wie Überlegungen des Spekulativen Realismus oder der OOO nirgends eine Spur hinterlassen zu haben scheinen.…oder ist mir da etwas entgangen?
Lieber Themba Mabona,
seitens der Redaktion herzlichen Dank für Ihren Hinweis! Tatsächlich haben uns nach unserer ersten Ausgabe „Wir Cyborgs“ und nach der dritten zu „Pornografie“ nur noch wenige Artikel mit einem entsprechendem theoretischen Hintergrund erreicht. Gerade angesichts unserer kommenden Ausgabe zu „Jungen Männern“ freuen wir uns sehr über Beitragsvorschläge vor einem entsprechenden Setting. Einsendungen bis 4. März sehr erwünscht! Vermutlich lässt sich an diesem Thema OOO sehr grundsätzlich und auch einfach vorführen.
Mit herzlichen Grüssen,
Corinna Virchow