Seit 2015 wächst in Mailand der Wald vertikal. Bosco Verticale ist ein vom Architekten Stefano Boeri entworfener Wohnkomplex aus zwei Türmen, 110 und 80 Meter hoch. Rund 800 Bäume, Tausende von Sträuchern und Stauden gedeihen hier auf Balkonen und Terrassen. Vermarktet wird der Komplex als Beitrag zur ökologischen Stadterneuerung. Inmitten einer Stadt, die seit Jahrzehnten vergeblich gegen die Luftverschmutzung ankämpft, sollen sich nun die klimatischen und ästhetischen Qualitäten des Waldes reinigend entfalten. In Lausanne baut Boeri mit dem Tour des Cèdres einen weiteren Waldturm. In der chinesischen Stadt Shijiazhuang plant er gar eine ganze Forest City für 100.000 Menschen.
Solche Immobilien seien der Versuch, „eine Art urtümlichen Paradiesgarten in unseren Wohn- und Arbeitsbereichen nachzubilden“, sagt die Architektur-Beobachterin Jill Fehrenbach (zitiert in Babbs 2013). Damit behält sie mehr als recht. Denn das ursprüngliche Paradies in der persischen Antike beinhaltete nicht nur die Harmonie zwischen Mensch und Natur, sondern auch die Mauern, die den herrschaftlichen Lustgarten abgrenzten – pairidaëza. Das Paradies ist exklusiv im doppelten Sinn: Ein Quadratmeter Wohnfläche kostet bis zu 12.000 Euro im ‚urbanen Ökosystem‘ Bosco Verticale und der Zutritt ist nur über eine Lobby möglich, in der Concierges den Zugang kontrollieren und über die Sicherheit wachen.
Bosco Verticale in Mailand
(Bild: Lorenzo Click, Flickr)
Das Paradies ist ein exklusiver Ort
Die gegenwärtige Symbolökonomie preist in vielen europäischen Städten kostspielige Wohnanlagen als herrschaftliche Lustgärten an. Sie führen das Paradiesische als „Gärten“, „Parks“ usw. im Namen. So bietet der einschlägige Investor Frankonia Eurobau in Deutschland von den Sophienterrassen in Hamburg bis zu den Lenbachgärten in München eine ganze Reihe solcher Anlagen. In Leipzig entstand die als Gated Area firmierende Central Park Residence, in Aachen der Barbarossa Park, in Potsdam heißt die Gated Community gleich Arcadia. Überall regeln Concierges mit ihren digitalen Sicherheitsnetzwerken den Zutritt.
„Eine Gated Community beschreibt einen geschlossenen Wohnkomplex mit verschiedenen Arten von Zugangsbeschränkungen. Die Größe von Gated Communitys variiert von einzelnen bewachten Appartementblöcken bis hin zu großflächigen Siedlungen mit über 100.000 Einwohnern mit eigener Infrastruktur wie Einkaufsmöglichkeiten, Gemeinschaftseinrichtungen, eigenen Schulen und Krankenhäusern und sogar eigenen Bürozentren und Arbeitsstätten.“ (Wikipedia)
Gemäß Wikipedia gelten in Deutschland folgende Anlagen als Gated Communitys:
- Arcadia-Wohnanlage in Potsdam
- Barbarossapark in Aachen
- Wohnanlage am Olympiapark in München
Es entstehen Räume der residenziellen Segregation, deren symbolische Grenzen zugleich manifeste Grenzen sind, oft ganze Quartiere von einiger Größe, zu denen nur Berechtigte Zutritt haben; ganz, wie es für Paradiese vorgesehen ist. Das Paradiesische dieser ‚Gärten‘, Gated Areas oder Communities erschöpft sich meist im Namen; daran ändern auch die obligatorischen Grünanlagen nicht viel. Gelegentlich aber gehört das Paradiesische auch explizit zum Baukonzept.

Die bereits erwähnte Frankonia Eurobau stellte 2009 in Münster 2009 die Klostergärten fertig. Dafür wurde eigens ein Franziskanerkloster aus dem 19. Jahrhundert abgerissen, wobei die Klostermauern erhalten blieben – ergänzt nun um hohe Zäune. Ein „Stadtpalais“ und vier „Stadtvillen“ sind um einen Gartenhof mit einem zentralen Brunnen gruppiert. Arkaden wollen einen Kreuzgang suggerieren. Frankonia vermarktete die Anlage ausdrücklich als hortus conclusus. Bemüht wird damit das seit der Antike bekannte Motiv des geschlossenen Gartens, dessen Mauern das paradiesische Innen – den lieblichen Ort (locus amoenus) also – vor dem schrecklichen Außen (locus terribilis) schützen.
Geschützt werden soll in den Klostergärten ein „[p]rivilegiertes Leben auf höchstem Niveau […], geprägt von Komfort, Sicherheit und Exklusivität“, so der Investor. Schließlich seien Klöster historisch schon immer auch Rückzugsorte für weltliche Herrscher gewesen, was man nun „konsequent in unsere Zeit übersetzt und modernen Erfordernissen angepasst“ habe (Zitate in Termeer 2010). Architektonisch stützt sich diese Übersetzung in unsere Zeit regelmäßig auf Formen der Art Déco oder aber des Neo-Neoklassizismus – auf eine Formensprache der konservativen Bürgerlichkeit.
Als eine ganz andere Variante des paradiesischen Exklusiv-Wohnens warten die Vertikalen Wälder in Mailand und Lausanne, aber auch die Urban Villages wie das Greenwich Millennium Village in London oder der Berliner Marthashof auf. Die zeitgenössische, oft verschachtelte (Hochhaus-)Architektur betont im Vergleich zur konservativen Bürgerlichkeit eher die „ganzheitlich ökologischen“ Konzepte.
Das Londoner Dorf wirbt mit Parks, altem Baumbestand, naturnahen Gehölzen und Seerosenteichen, bietet aber auch ganze Wohnblocks mit zehn Etagen. Dagegen ist die Bebauung beim Marthashof in Berlin-Prenzlauer Berg mit seinen Garden und Town Houses kleinteiliger. Das Marketing setzt hier auf die Erneuerung einer – sehr exklusiven – Dorfidylle. Hier herrschen „Harmonie“ und „Gemeinschaft“, es gibt „Freiraum und Geborgenheit“ und keine „Angst vor der Einsamkeit oder einem Burnout“. Die Menschen finden ihr Seelenheil – auch ökologisch, mit all den Hausbegrünungen, Holzpelletheizungen und Regenwasserauffangsystemen. Kurz: „Beinahe eine Klosteridylle“ (Zitate in Rensch o.J.).
Bosco Verticale ist ein wahrlich herausragendes Beispiel für die Ausrichtung der postfordistischen Stadtpolitik auf die Bedürfnisse einer finanzkräftigen Klientel.
Hochpreisiges Wohnen kann ebenso als vorgeblicher Dienst an der Allgemeinheit daher kommen. Die Werbung für Bosco Verticale betont, dass die Begrünung der Häuser im Gegenwert eines Hektars Wald klimatisch dem ganzen Viertel nütze. De facto aber musste für den Bau ein beliebter öffentlicher Park dran glauben. Bosco Verticale ist ein wahrlich herausragendes Beispiel für die Ausrichtung der postfordistischen Stadtpolitik auf die Bedürfnisse einer finanzkräftigen Klientel.
Das Paradies ist ein Produkt postfordistischer Stadtpolitik

Im Fordismus galten die Städte noch als ausführende Organe des nationalen Sozialstaats. Bis in die 1980er Jahre war aufgrund des Wettbewerbs zwischen den Nationen noch keine Konkurrenz unter den Städten auszumachen. Das hat sich Postfordismus der letzten 20 Jahre signifikant verändert. Seitdem herrscht ein permanenter, nationaler wie internationaler Wettbewerb unter den Städten – ein Kampf, der nicht zuletzt in den Stadtrankings zum Ausdruck kommt. In diesem Wettbewerb definieren sich die Städte zunehmend als Unternehmen und handeln dementsprechend.
Städte sind zu einer wichtigen Klientel von Unternehmensberatungen à la McKinsey geworden, sie müssen sich in Rankings bewähren und entwickeln Managementstrategien und Verkaufs-Storys im Wettbewerb um wohlhabende Haushalte, Tourist*innen, Dienstleistungsunternehmen und Investor*innen. Als Rendite dieses Wettbewerbs sollen Imagegewinne, neue Arbeitsplätze und steigende Steuereinnahmen winken.
Eine postfordistische Stadtpolitik betreibt eine ‚Renaissance der Innenstadt‘ zugunsten prosperierender Bevölkerungsgruppen und ihrer Wohnbedürfnisse. Zwangläufig führt dies – oft auch gewollt – zur Verdrängung wenig kaufkräftiger Einwohner*innen. Im Rahmen dieser Politik gerät auch der öffentliche Raum unter Druck. Ist er nicht schon privatisiert, wird er bestens kontrolliert: Public private partnerships sorgen zum einen für seine ästhetische Aufwertung, zum anderen für eine ‚angemessene‘ Bespielung mit Konzerten oder Open-Air-Kinos. Kommunale oder private Sicherheitsdienste achten längst nicht mehr nur auf Sicherheit, sondern zunehmend auch auf Sauberkeit. Der öffentliche muss wie der private Raum stets vorzeigbar sein.
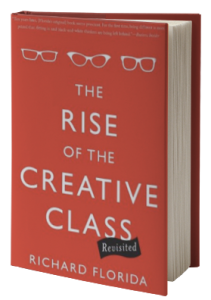
Aktuelle Strategien zur Aufwertung von Stadtlandschaften berufen sich regelmäßig auf die Thesen des Ökonomen Richard Florida, der die überragende Bedeutung der creative class für das ökonomische Wachstum einer Stadt betont. Die Herausstellung des Kreativen verweist auf ein weiteres Merkmal postfordistischer (Stadt-)Strukturen: Sie sind durchaus offen für ehemals oppositionelle, postmaterialistische Positionen und Strategien. Als ‚kreative‘ Lösungen fügen sie sich heute bestens in das Marketing ‚innovativer‘ Städte.
In den 1970er und 80er Jahren sehnten viele links-alternativen Utopien das Aufbrechen grauer fordistischer Strukturen durch den Einbruch grüner Natur herbei. Das Ziel waren urbane Paradiese fernab des Kapitalismus. 1975 erschien Ernest Callenbachs Roman Ökotopia, der von einem ländlichen neuen San Francisco im Jahr 1999 träumte – von einer Stadt mit Wasserfällen, Bäumen und Straßenlöchern voller Blumen.
Der Wunsch, Städte in Palmenstrände zu verwandeln, bewegte ausserdem die „Jugendunruhen“ in Zürich und Bern (vgl. Beitrag Ueli Mäder). 1984 entwarf die feministische Architektin Annelie Schliecker Häuser und Stadtteile, die mit „wild wachsenden Pflanzen“ und Nutzgärten begrünt waren und einen Beitrag zum Ökosozialismus leisten sollten. Auch Joseph Beuys‘ Pflanzaktion 7000 Eichen an der Documenta Kassel gehörte unter dem Motto Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung zu dieser grünen Aufbruchstimmung (vgl. Termeer 2016). Und nicht zuletzt entstand in Wien mit dem Hundertwasserhaus (entworfen vom Maler Friedensreich Hundertwasser) gar ein ‚bewaldeter‘ Bau mit 50 Sozialwohnungen.

Heute gehören solche Ausbrüche aus bürokratisierten Arbeits- und Lebensstrukturen, solche ‚Verflüssigungen‘ ehemals starrer urbaner Grenzen zum Alltag innerhalb des Kapitalismus. Ideen einer grünen Opposition von damals sind Bestandteile einer postfordistischen Stadtpolitik von heute. Der Wandel zeigt sich an etwa an heutigen Konzepten zur ‘Verwilderung’ von urbanen Brachflächen, an der Duldung von Füchsen oder Wildschweinen in der Stadt oder aber in umfassenden Strategien zur Begrünung und Renaturierung.
Das Paradies ist ein umkämpfter Ort
Einen Kontrapunkt zu diesen kapitalistischen Verflüssigungen will das basisaktivistische Urban Gardening setzen. Es versucht, Freiräume sozialer Kooperation, des Protests und alternativer Praktiken der Selbstversorgung zu schaffen und marktfreien Räumen eine Chance zu geben (Müller, C. 2013). Doch selbst so widerständige Räume können – entgegen der Motivation ihrer Protagonist*innen – vom Marketing vereinnahmt werden. Städte rühmen sich heute in Imagekampagnen oft ihrer Subkultur, gehört doch zu solchen place brandings die permanente Produktion auf- und anregender Atmosphären, gerade auch durch „Abweichungen und Besonderheiten“ (Reckwitz 2012).
Zugleich sind die Paradiese der Subkultur stets auch Verfügungsmasse. Sie müssen meist geräumt werden, wenn Investor*innen ihre Projekte umsetzen – etwa hochpreisige Architekturen im Zeichen der Nachhaltigkeit. Doch auch die Realisierung von Prestige-Projekten verläuft keineswegs bruchlos, wie das Beispiel des Berliner Marthashofs zeigt. Seit seiner Planung lehnen Initiativen und Stadtteilgruppen das Projekt als „Super-Gentrifizierung“ ab.
Der Weg ins Paradies steht eben nicht allen offen.
Der Marthashof illustriert nebenbei eindrücklich, wie sich die Verflüssigungen von Grenzen im Postfordismus artikulieren. Das Leben im Einklang mit der Natur soll mit dem Genuss des Exklusiven, das beschaulich Rurale mit dem komfortabel Urbanen gepaart werden. Dieses und andere Beispiele erscheinen wie ein Versprechen auf ein Paradies im Hier und Jetzt, dank ihrer untrennbaren Verbindung von Nachhaltigkeit und Luxus. Und selbst die für Paradiese kennzeichnende Langeweile soll hier nicht aufkommen, existieren sie doch inmitten der „aufregenden“ urbanen Vielfalt der Großstädte. Oder, wie es für den Marthashof heißt: „Trendig, kulturell, exotisch […]. Abwechslungsreich und vielfältig“ (Zitat in Rensch o.J.).
Das 30-geschossige Hochhaus Harmony Village in Toronto will den Baby-Boomern allen Luxus und Schutz bieten – dank Concierge. (Bild: © City Core Developments)
Zugangskontrollen und Sicherheitssysteme halten wiederum die bedrohlichen Seiten der urbanen Vielfalt draußen. Urban Villages sind mit elektronischen Einlasskontrollen und audivisuellen Überwachungssystemen ausgerüstet. Der Zugang zur Dorfidylle des Marthashof ist durch ein meist verschlossenes Tor geregelt. Und im Bosco Vertikale, in den Quartieren der Frankonia Eurobau und vergleichbaren Immobilien dienen Concierges der Sicherheit einerseits, dem Distinktionsgefühl andererseits.
Postfordistische Stadtstrukturen bieten neue Öffnungen, ebenso aber neue Schließungen. Der Weg ins Paradies steht eben nicht allen offen.
Literatur
Babbs, Helen. 2013. „High-rise gardening. When is a skyscraper not just a skyscraper? When it’s a garden“. The Guardian, Februar 27. Online.
Müller, Christa. 2013. „Sehnsuchtsstadt statt Landlust. Wie postindustrielle Sehnsuchtsorte des Selbermachens und der Naturbegegnung neue Bilder von Urbanität entwerfen. In: Marco Thomas Bosshardt u.a. (Hg.). Sehnsuchtsstädte. Auf der Suche nach lebenswerten urbanen Räumen. Bielefeld: Transcript, 141–151 (Zitat S. 147f.).
Reckwitz, Andreas. 2012. Die Erfindung der Kreativität. Zum Prozess gesellschaftlicher Ästhetisierung. Berlin: Suhrkamp (Zitat S. 306).
Rensch, Ulrike. O.J. „Urban Village: Vorort-Flair direkt am Prenzlauer Berg in Berlin“. Online.
Termeer, Marcus. 2016. Menschen mit fremden Wurzeln in hybriden Stadtlandschaften. Versuch über Identität und Urbanität im Postfordismus. Berlin: Neofelis (Zitate auf S. 74–80).
Termeer, Marcus. 2010. Münster als Marke. Die »lebenswerteste Stadt der Welt«, die Ökonomie der Symbole und ihre Vorgeschichte. Münster: Westfälisches Dampfboot (Zitate auf S. 77).
Bildnachweis
Das Titelbild wurde uns freundlicherweise von Lumas zur Verfügung gestellt.
Bildtitel: E la nave va Nº 1
Jahr: 2013/14
Künstlerin: Isabelle Menin
Erhältlich bei: www.lumas.com
uncode-placeholder
Marcus Termeer
Marcus Termeer ist promovierter Soziologe und freier Autor in Freiburg/Breisgau. Er beschäftigt sich mit den Strukturen urbaner Räume sowie mit Naturalisierungen sozialer Konstruktionen. Zuletzt erschien sein Buch Menschen mit fremden Wurzeln in hybriden Stadtlandschaften. Versuch über Identität und Urbanität im Postfordismus (Berlin 2016: Neofelis).



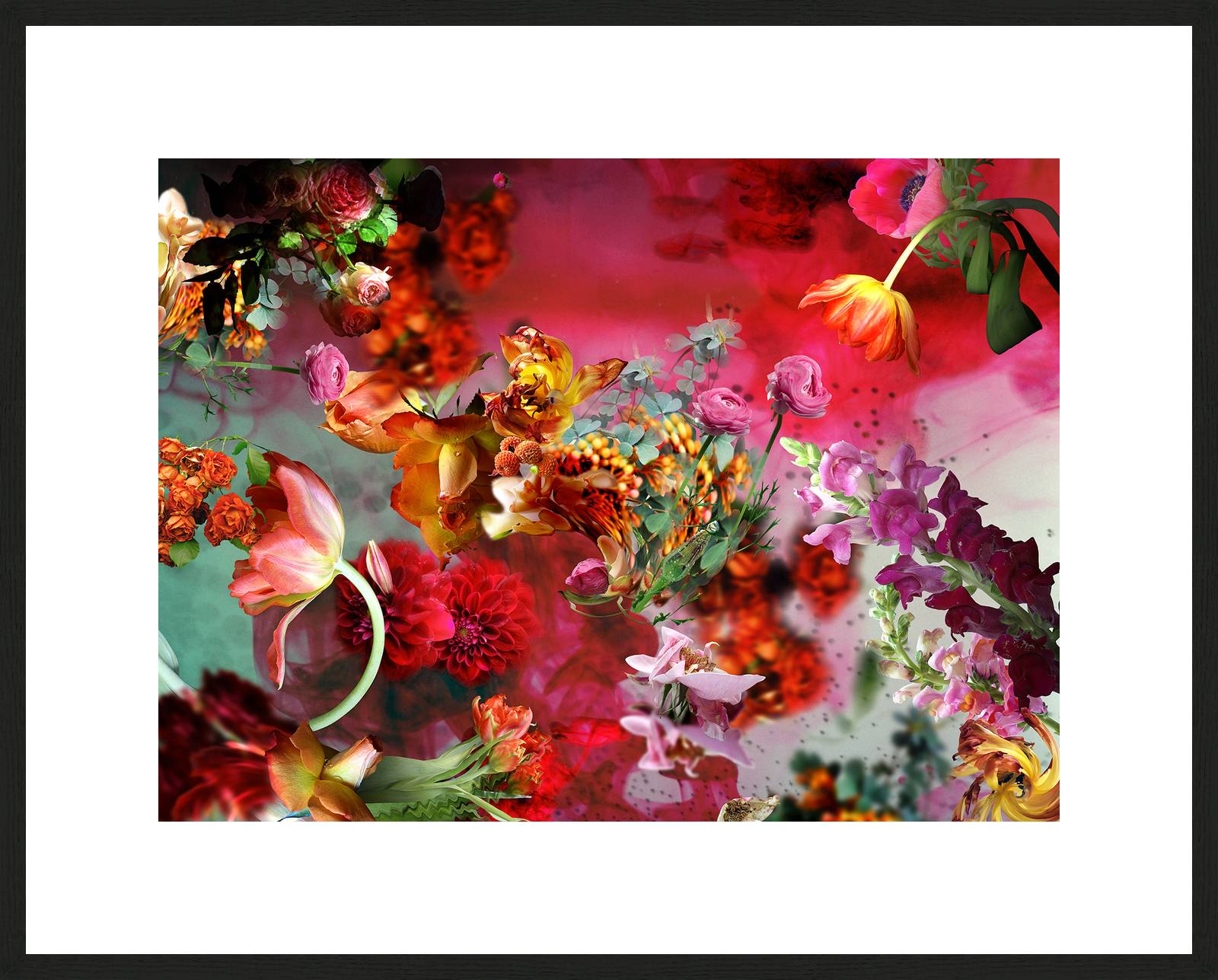








Lieber Herr Termeer, das ist schon ein guter Witz, den die Werbetexter dieser „Paradiese“ sich hier erlauben. Dass zumindest im Mittelalter der Rückzug von weltlichen Herrschern in ein Kloster gerade eine Absage an den Komfort zugunsten des Seelenheils darstellte (oder dies zumindest von den meisten Chronisten so behauptet wird), interessiert da wohl nicht weiter. Ein schönes Beispiel dafür,wie kapitalistische Mechanismen sich des geschichtlichen Vergleichs bemühen, paradoxalerweise ohne diesen geschichtlich zu verankern – Geschichte als Ware und als solche stets top-aktuell. Diese Paradoxie ist dann wohl die wirkliche „Übersetzung in unsere Zeit“.
Die Investoren und ihre Marketingabteilungen gehen – wohl zurecht – davon aus, dass ihren Kund*innen solch ahistorische Konstruktionen nicht auffallen; zumal sie sich ja durch diese gerade geschmeichelt fühlen sollen.
Wie weit das Spiel mit der Geschichtsvergessenheit gehen kann, lässt sich an weiteren Immobilien der Frankonia Eurobau zeigen. In Düsseldorf heißt ihr abgeschottetes Luxusquartier „Heinrich Heine Gärten“. Das „Himmelreich […] auf Erden […] für alle Menschenkinder“ (wie es Heine dichtend anstrebte) gibt es hier ja aber gerade nicht. Den Eingang des Quartiers bildet eine Art neoklassizistischer Triumphbogen.
Zum Quartier „Sophienterrassen“ in Hamburg-Harvesterhude gehört gar eine 1935/37 als „Graue Festung“ erbaute Wehrmachtskaserne. Der monumentale, im NS-Stil mit steinernen Adlern und Schwertern geschmückte Bau heißt nun „Sophienpalais“. „Wie ein herrschaftliches Stadtschloss“, so die Frankonia 2009, soll er die Bewohner*innen empfangen. Dieser – gelinde gesagt – problematische Umgang mit der Geschichte hat offenbar ein Ziel: die Etablierung „wirklich exklusive[r] Wohngebiete“ in europäischen Innenstädten (Manuel Castells) durch Adaption bzw. Integration historischer Herrschaftsarchitektur.
Etwas anders sieht das beim Bau urbaner Öko-Paradiese aus. Hier dienen etwa spektakuläre Renaturierungen dem Distinktionsgewinn. Seit kurzem gibt es z.B. in Turin ein fünfstöckiges Wohnhaus, überwiegend aus Holz gebaut und mit 150 Bäumen bestückt. Dieses „Treehouse 25 Verde“ kommt als Hybrid aus Ruralem und Urbanem daher, wirkt zunächst wie der Traum einer links-alternativen Kommune der 1970/80er Jahre. Es ist aber von einer Mauer umgeben und bietet strikt nachhaltiges Wohnen im Luxusbereich.
Wie schon geschrieben: Postfordistische Strukturen sind recht offen für die Übernahme – nun allerdings transformierter – ehemals oppositioneller Ideen. Das „Hybride“ ist in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung. Es oszilliert zwischen einem Begriff des Gegenkulturellen und einem Leitbegriff des gegenwärtigen Kapitalismus. Aktuelle Tendenzen einer Vermischung von Großstädtischem und Ländlichem werden dann ja auch diskutiert als hybride Stadtlandschaften, produziert von unterschiedlichen Akteur*innen mit unterschiedlichen oder gegensätzlichen Motivationen.
Die hier beschriebene Vermischung von ruralen und urbanen Formen und Ästhetiken, wie hier sehr klarsichtig verdeutlicht, wird auch außerhalb Europas höchst erfolgreich praktiziert, so z.B. auch in den USA, im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Dort wird als Teil eines Stadtentwicklungsprojekt mit dem durchaus grotesk anmutenden Namen “Pacific Park” eine postindustrielle Stadtlandschaft nun zu einer ebenfalls privaten, abgeschlossenen Apartmentanlage umgestaltet. Der namengebende Park ist dabei bestenfalls schmückendes, wohlklingendes Beiwerk für exklusive Hochpreisimmobilien.
Gleichzeitig vermag auch Richard Florida selbst wohl mittlerweile eingesehen haben, dass der Einzug der “Creative Class” zwar oft zum von ihm herbeigeschriebenen Ergebnis führte, jedoch gleichzeitig auch zur Verdrängung und Exkludierung anderweitiger Bevölkerungsgruppen.
Wie allerdings bereits der Titel seines dieses Jahr erschienenen Bandes The New Urban Crisis: How Our Cities Are Increasing Inequality, Deepening Segregation, and Failing the Middle Class-and What We Can Do About It veranschaulicht, fühlt sich der Autor auch ein zweites Mal berufen, Städten weltweit seine Dienste anzutun.
Toller Artikel. Die Erhellung des asiatischen Sonderfalles Singapur wäre evtl noch bereichernd gewesen. Ganz oben auf dem Green City Index trifft hier grün-spriesender Nachhaltigkeitsmaximalismus auf authoritäre Herrschaftspolitik (siehe Harvard Political Review).…Biopower in jeder Hinsicht…